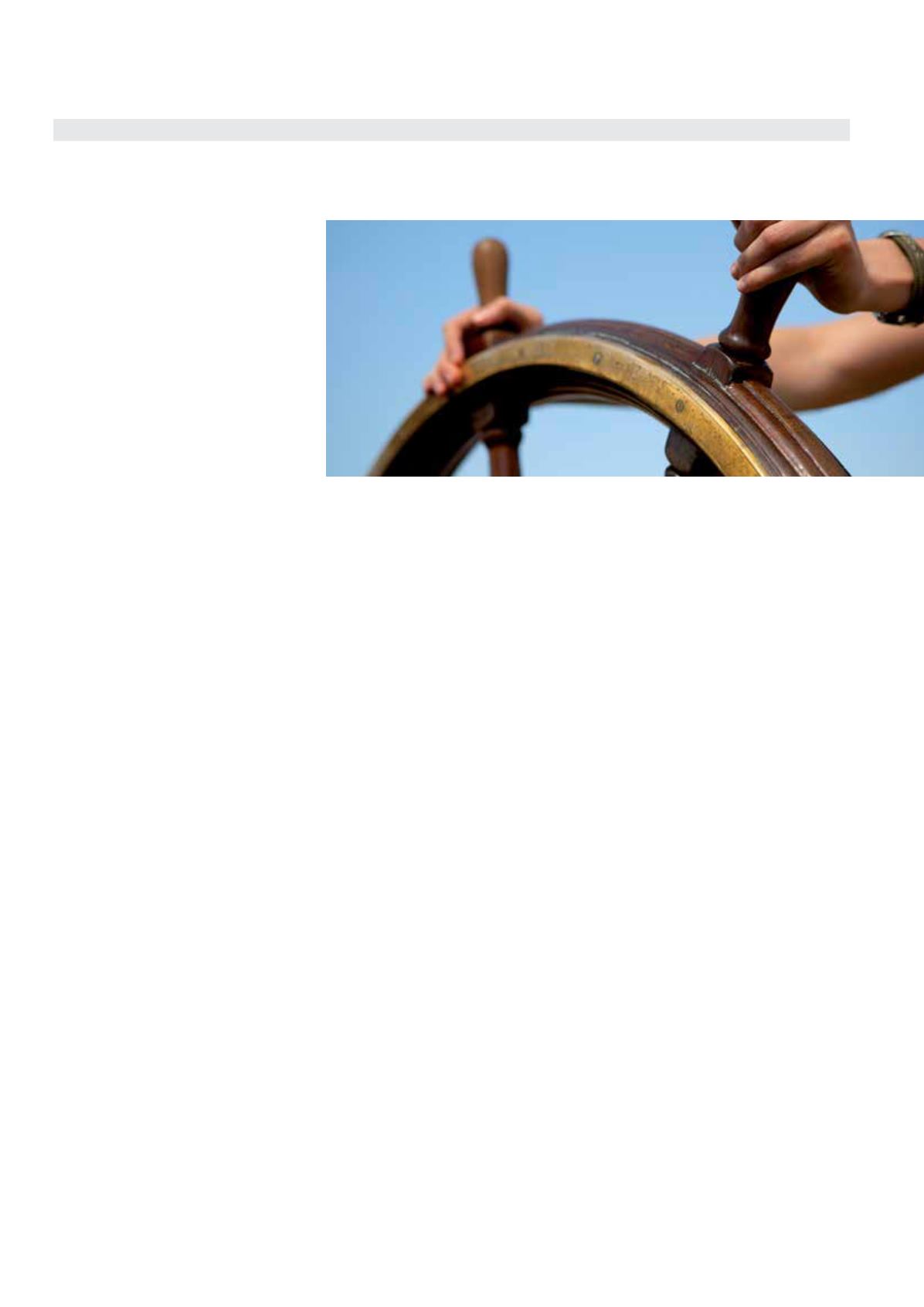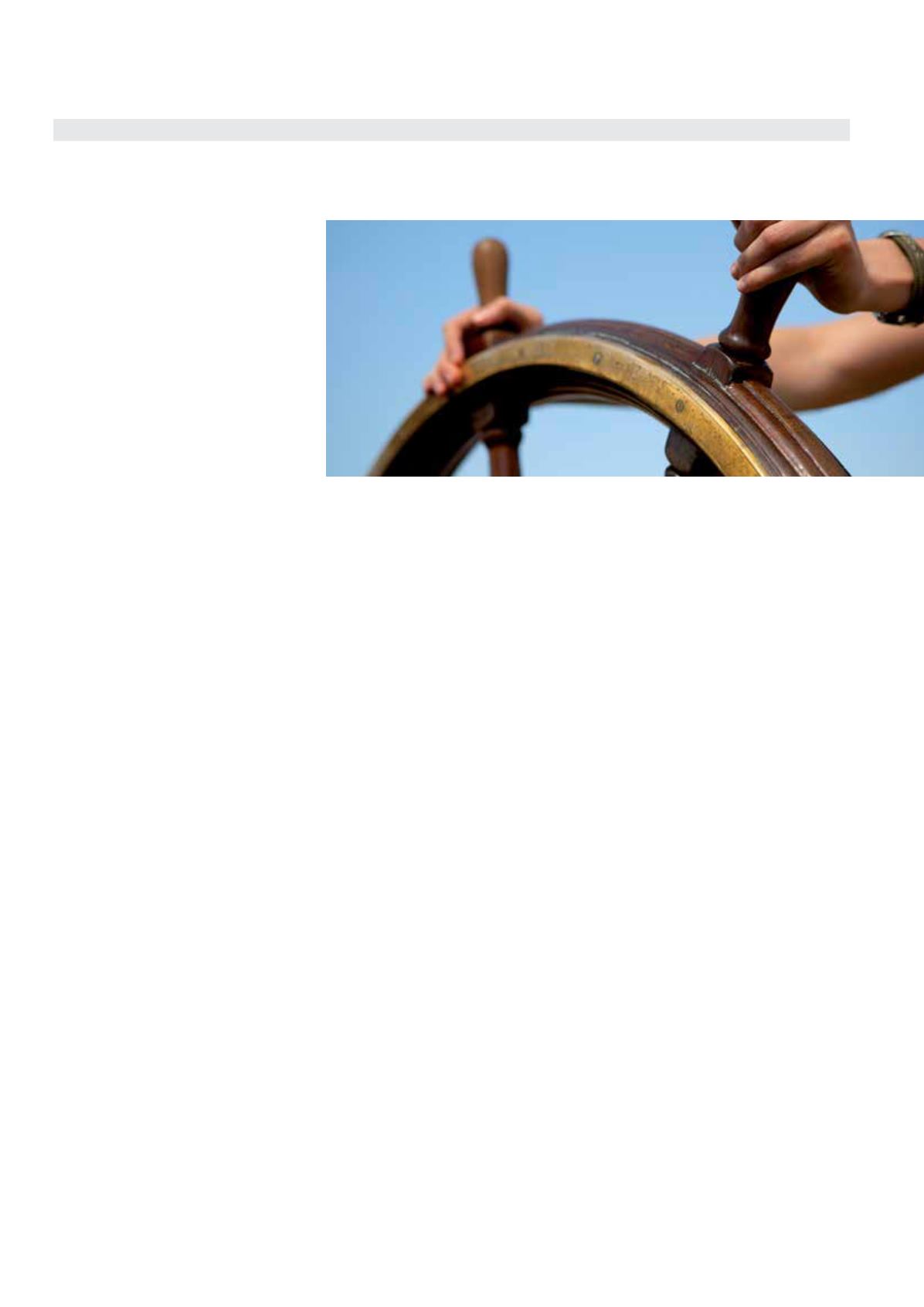
Vorschläge zum Vorgehen
Erstens sollte die Erarbeitung der Lan-
desplanung einem hochrangigen Experten-
gremium übertragen werden. Die Definition
strategischer Leitlinien, die Identifizierung
von Schwerpunkten und Themen sowie die
Benennung wünschenswerter Entwicklungen
des Hochschulbereichs in quantitativer wie
qualitativer Hinsicht stellen hohe Anforde-
rungen. Das Expertengremium sollte bei hin-
reichend breiter Zusammensetzung imstande
sein, unterschiedliche Perspektiven auf Hoch-
schule und Wissenschaft zusammenzufassen
und aufzubereiten. Seine Aufgabenstellung
sollte eng gefasst werden und außer der
Erarbeitung eines Landeshochschulentwick-
lungsplanes zur Vorlage an den Wissen-
schaftsausschuss und das Parlament auch
die Beratung des nordrhein-westfälischen
Ministeriums für Innovation, Wissenschaft
und Forschung in grundsätzlichen Fragen
der gesamten Entwicklung umfassen.
Zweitens erfordert eine sachgerechte
Hochschulentwicklungsplanung eine gute
Datenbasis: Eine Weiterentwicklung des
Hochschulrechts muss ein Controlling auf
Landesebene in Wirtschafts-, Haushalts- und
Personalangelegenheiten erlauben. Langfris-
tig aussagefähige Daten und ein zielorien-
tiertes Berichtswesen müssen gesichert sein.
Drittens sollte mit einer Stärkung der Hoch-
schulforschung dafür gesorgt werden, dass
beteiligten Akteuren ein solides Wissen über
Hochschulen, Strukturen und Prozesse sowie
Leistungen und Defizite zur Verfügung steht.
Bärbel Rompeltien, Referat Wissenschaft
und Hochschule der GEW NRW
Landesinteresse auf einer möglichst hohen
Masterquote bestehen muss.
Eine strategische Landesplanung ist aber
auch für die Forschung sinnvoll und gebo-
ten. Nicht zuletzt unter dem Aspekt, dass
eine Hochschulentwicklungsplanung auf
Landesebene auch die Grundlage für die
Ressourcenzuweisung an die Hochschulen
sein muss.
Regelungen festlegen und umsetzen
Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen
zwischen Ministerium und Hochschulen sol-
len auf dem Hochschulrecht basieren. Die
bisherige Praxis aber ist in dieser Hinsicht
nicht überzeugend, unter anderem weil die
Ziel- und Leistungsvereinbarungen weitge-
hend auf quantitative Aspekte beschränkt
waren. Wenn nun die Eckpunkte im Entwurf
des Hochschulzukunftsgesetzes eine für die
gesamte Hochschullandschaft verbindliche
strategische Planung des Landes in Gestalt
eines Landeshochschulentwicklungsplanes
ankündigen, ist das begrüßenswert. Der
Entwicklungsplan soll parlamentarisch ver-
abschiedet werden und zugleich auch die
Grundlage für die Ressourcenzuweisung
an die Hochschulen abgeben. So könnte
die oft kontraproduktive Wirkung einer nur
auf quantitativen Kennzahlen beruhenden
Finanzautomatik abgemildert werden. Die
Aufstellung eines Landeshochschulentwick-
lungsplanes ist keinesfalls trivial. Es sollten
Regelungen gefunden und auch im Hoch-
schulzukunftsgesetz verankert werden, die
auf seine Akzeptanz hinwirken.
Strategie für eine fundierte Landesplanung der Hochschulentwicklung
Demokratische Steuerung in eine bessere Zukunft
Das geltende Hochschulrecht be-
stimmt in § 6, dass das Land strate-
gische Ziele zur Hochschulsteuerung
entwickelt und damit Leistungen
sichert. Doch ein Fehler im Sys-
tem schränkt jene Handlungs- und
Gestaltungsebene des Landes ein:
Die kontroverse Diskussion um die
Steuerung und Autonomie ist auf die
hochschulinterne Verteilung von Auf-
gaben und Kompetenzen zwischen
Hochschulleitung, Hochschulrat und
Senat konzentriert. Was das Verhält-
nis zum Land anbelangt, lauten die
Forderungen in den Stellungnahmen
immer gleich: keine Rückkehr zur
Detailsteuerung durch die staatliche
Bürokratie. Doch diese strebt keine
der Seiten an. Vielmehr muss eine
strategische Landesplanung her, um
das Steuerungsdefizit auszugleichen.
Schon vor gut einem Jahr kritisierte NRW-
Wissenschaftsministerin Svenja Schulze zu-
treffend, dass das Hochschulgesetz bisher
die Summe der Einzelinteressen autonomer
Hochschulen gleichsetzt mit dem Landes-
interesse. Dass das nicht der Fall ist, zeigen
die Beispiele Lehrerausbildung und das
Angebot sogenannter kleiner Fächer sowie
von Masterstudienplätzen.
Einzelperspektive versus
Landesinteresse
Der seit Langem bestehende Lehrkräfte-
mangel für die berufliche Bildung erfordert
offensichtlich andere Steuerungsimpulse, als
die Hochschulen sie in ihrer jeweiligen Ein-
zelsituation in Konkurrenz zu andern Hoch-
schulen entwickeln können. Kleine Fächer
verschwinden aus den Hochschulplänen, da
sie sich in der einzelwirtschaftlichen Per-
spektive oft nicht rechnen. Ihr Wissen aber
wird gesellschaftlich benötigt. Auch für
den Bereich der Masterstudiengänge ist
eine Landesplanung dringend erforderlich.
Die Hochschulen haben das Interesse, die
Anzahl der Masterstudienplätze kleinzu-
halten, während ein wohlverstandenes
Foto: istockphoto.com