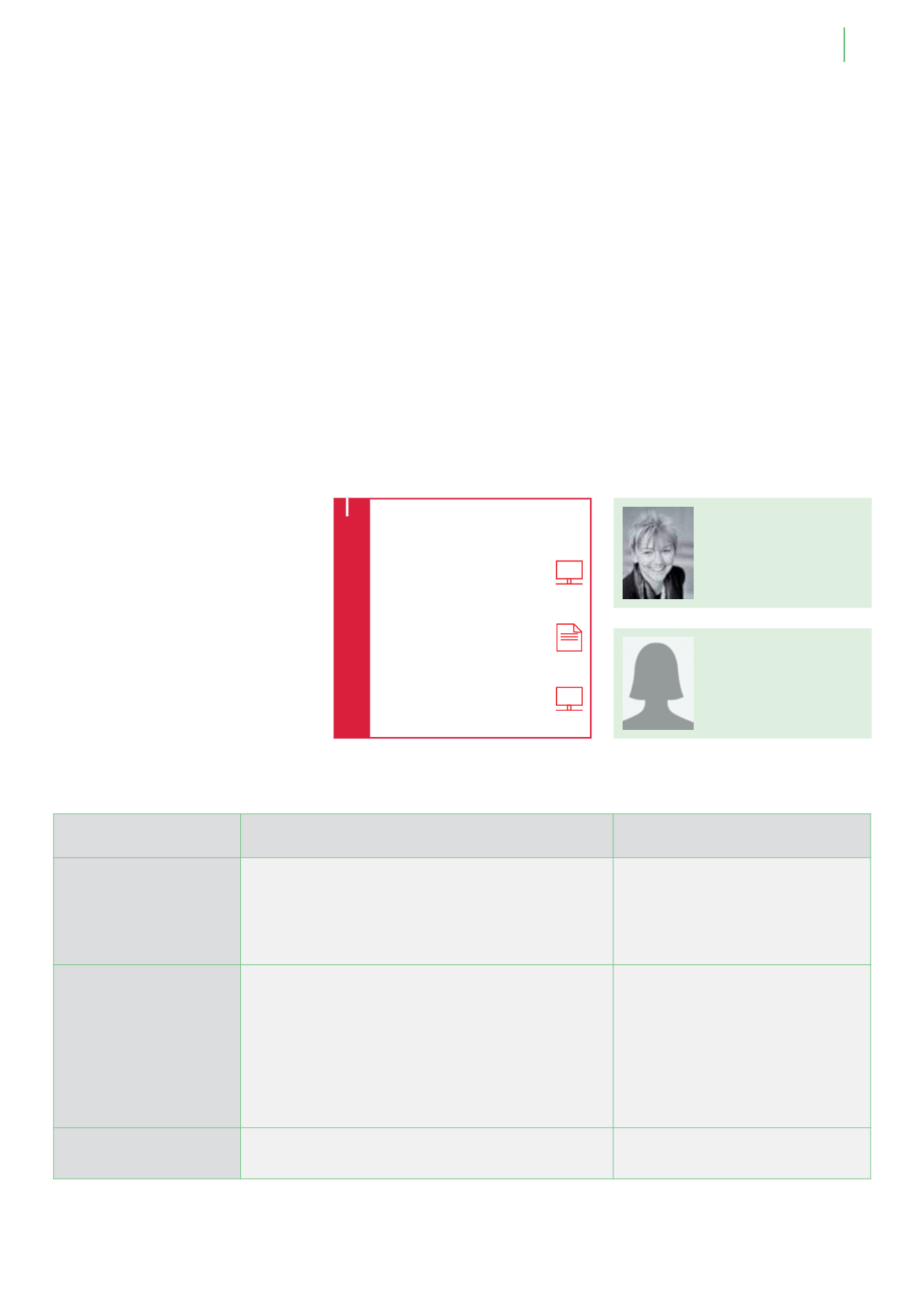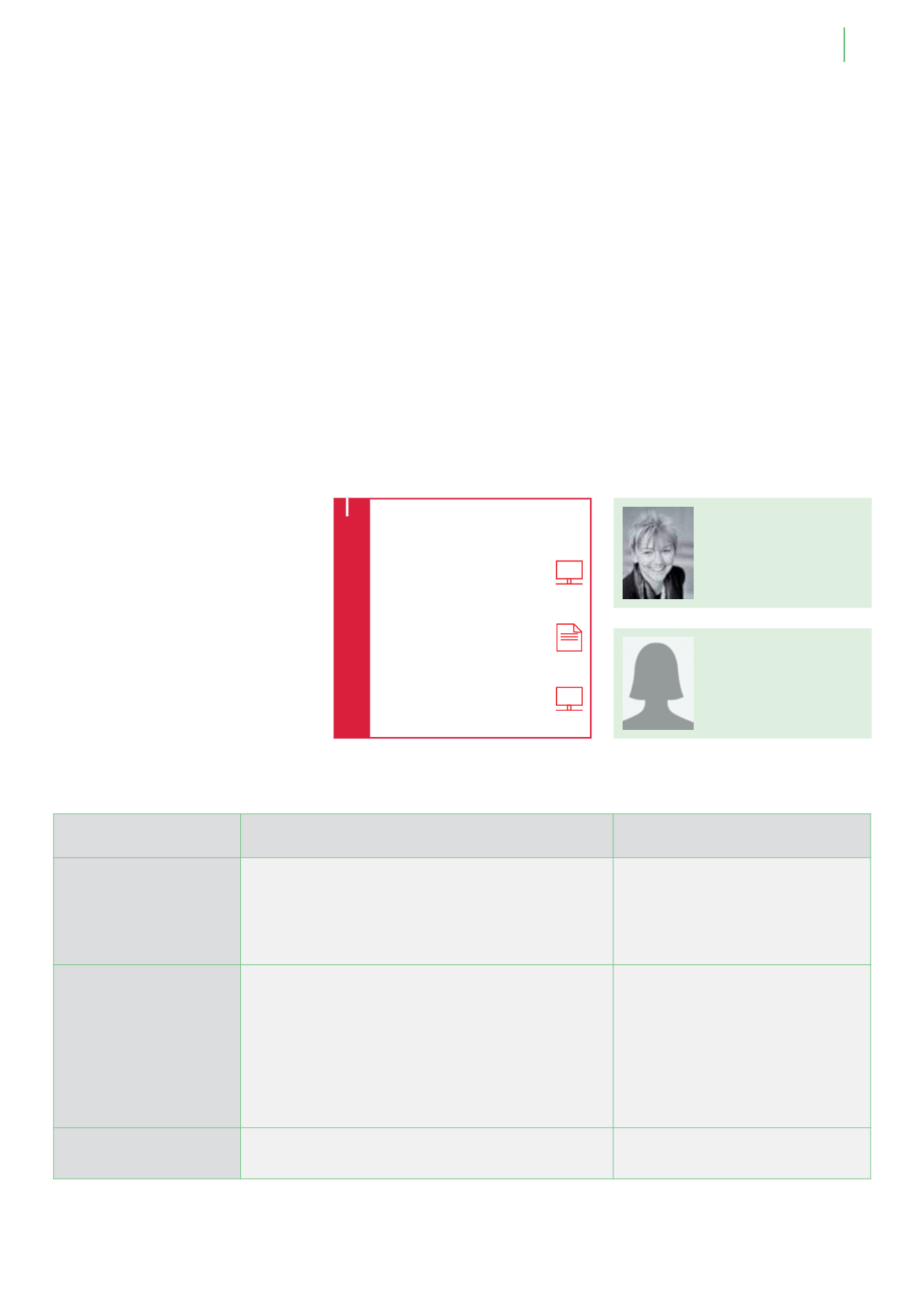
13
nds 11/12-2013
Nur wer sich damit nicht auseinandersetzt
und zudem die Geschichte der Elementar-
pädagogik in Deutschland ignoriert, kann
zu dem Schluss kommen: Die Fachschule
für Sozialpädagogik darf im Unterschied zur
Fachschule für Technik nicht auf der Ebene 6
des DQR eingeordnet werden, denn sie ist for-
mal keine echte Fachschule. Auf qualitativer
Ebene bewirkt diese Argumentation gewöhn-
lich nur eine Schlussfolgerung: Unecht kann
nur schlechter als eine echte Fachschule sein.
Qualitätsvorsprung für Fachschulen
Richtig ist – ohne gewisse formale Ein-
schränkungen vernachlässigen zu wollen –,
dass die vermeintlich „unechte “ Fachschule
für Sozialpädagogik in den meisten Bundes-
ländern
1. durch veränderte Strukturen längst auch
formal eine echte Fachschule ist und
2. auf der Ebene des allgemeinbildenden Ab-
schlusses die Eingangsvoraussetzungen für
die Fachschule für Sozialpädagogik höher
sind als für die anderen Fachschulen.
Im Vergleich zu den im Gründungsboom
vernachlässigten Qualitätsstandards der Studi-
engänge „Frühe Kindheit“ liegen diese für die
Fachschule für Sozialpädagogik vor. Darüber
hinaus haben die Fachschulen und Fachaka-
demien weitgehend Lernfeld-Lernpläne, die
eine verschulte Ausbildung wie in der starren
Struktur der Bachelorstudiengänge verhindern.
Behauptet wird, dass durch die Gründung
der Studiengänge „Frühe Kindheit“ eine
systematischere Forschungslandschaft ent-
stehen würde. Der Beweis bleibt aus. Der
Versuch, die Fachschule für Sozialpädagogik
formal abzugrenzen wird ergänzt durch nicht
belegte Behauptungen über die Ausbildung
an Fachschulen im Gegensatz zum eigenen
„forschenden Habitus“.
Gemeinsam wären wir stärker!
Die Strategie der Fachhochschulen mag
unter bestimmten Perspektiven, besonders
der der eigenen Identitätsvergewisserung,
verständlich sein. Doch kann es nicht im
Sinne der GEW sein, dass durch abgrenzende
Stellungnahmen das Tischtuch zwischen Fach-
schulen und Fachhochschulen zerrissen wird
Die DHQR-Grundstruktur besteht aus drei Stufen. Das Niveau 6 des DQR entspricht der Stufe 1 des DHQR. Quelle: Peter Dehnbostel, Harry Neß, Bernd Overwien (hrsg. von
der GEW): Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) – Positionen, Reflexionen und Optionen. Gutachten im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung. Seite 43.
GEW (Hrsg.): Der Deutsche
Qualifikationsrahmen (DQR)
– Positionen, Reflexionen und
Optionen. Gutachten im Auftrag
der Max-Traeger-Stiftung
DGB: Der Deutsche Qualifikati-
onsrahmen: Chancen und Risiken
aus gewerkschaftlicher Sicht
Gemeinsames Internetportal des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung und der Kultus-
ministerkonferenz
p us
Qualifikationsstufen
Formale Aspekte
Abschlüsse des Hochschulstudiums
Hochschulgrade und Staatsexamina
1. Stufe:
Bachelor-Ebene
Grade auf Bachelor-Ebene:
3, 3,5 oder 4 Jahre Vollzeitstudium bzw.
180, 210 oder 240 ECTS-Punkte;
alle Grade berechtigen zur Bewerbung für
Masterprogramme
B. A., B. Sc., B. Eng., B. F. A., B. Mus., LL.B.,
Diplom (FH), Staatsexamen
2. Stufe:
Master-Ebene
Grade auf der Master-Ebene:
normalerweise 5 Jahre Vollzeitstudium bzw.
300 ECTS-Punkte;
bei gestuften Studiengängen 1, 1,5 oder 2 Jahre bzw. 60, 90
oder 120 ECTS-Punkte auf Master-Ebene;
Typen von Master-Abschlüssen: stärker anwendungsorientiert,
stärker forschungsorientiert, künstlerisches Profil, Lehramtsprofil;
alle Grade berechtigen zur Bewerbung für ein Promotionsvorhaben
M. A., M. Sc., M. Eng., M. F. A., M. Mus.
LL.M., etc.
Diplom (Universität),
Magister, Staatsexamen,
nichtkonsekutive und weiterbildende
Master
3. Stufe:
Doktoratsebene
(Grade bauen in der Regel auf einem Abschluss auf Master-
Ebene auf, also von 300 ECTS-Punkten und mehr.)
Dr., Ph. D.
– zumal die Fachschul-KollegInnen regional
wesentlich zur Gründung von Studiengängen
inhaltlich beigetragen haben.
Möge im Sinne der Qualitätsentwicklung
der Elementarpädagogik langfristig gelingen,
was sich Manfred Müller-Neuendorf, Schul-
leiter des Erzbischöflichen Berufskollegs in
Köln, Michael Obermaier, Qualitätsbeauftrag-
ter und Fachlehrer an diesem Berufskolleg,
wünschen: „Aufs Ganze gesehen wird es also
zukünftig um ein produktives und konstruk-
tives Miteinander im multiprofessionellen Or-
chester der Ausbildung sozialpädagogischer
Fachkräfte gehen; im Ganzen eben um eine
hohe Klangqualität. Dafür braucht man zwar
immer auch eine erste Geige, die aber, je nach
vorgegebener Partitur, schon einmal wechseln
sollte.“
Hedwig Schomacher, Luise Quast
Studienstruktur im Europäischen Hochschulraum
Hedwig Schomacher
Mitglied im Ausschuss für
Schulleitung der GEW NRW
und Schulleiterin des Berufs-
kollegs Vera Beckers, Krefeld
Luise Quast
Sprecherin des Arbeitskreises
Sozialpädagogik der GEW NRW