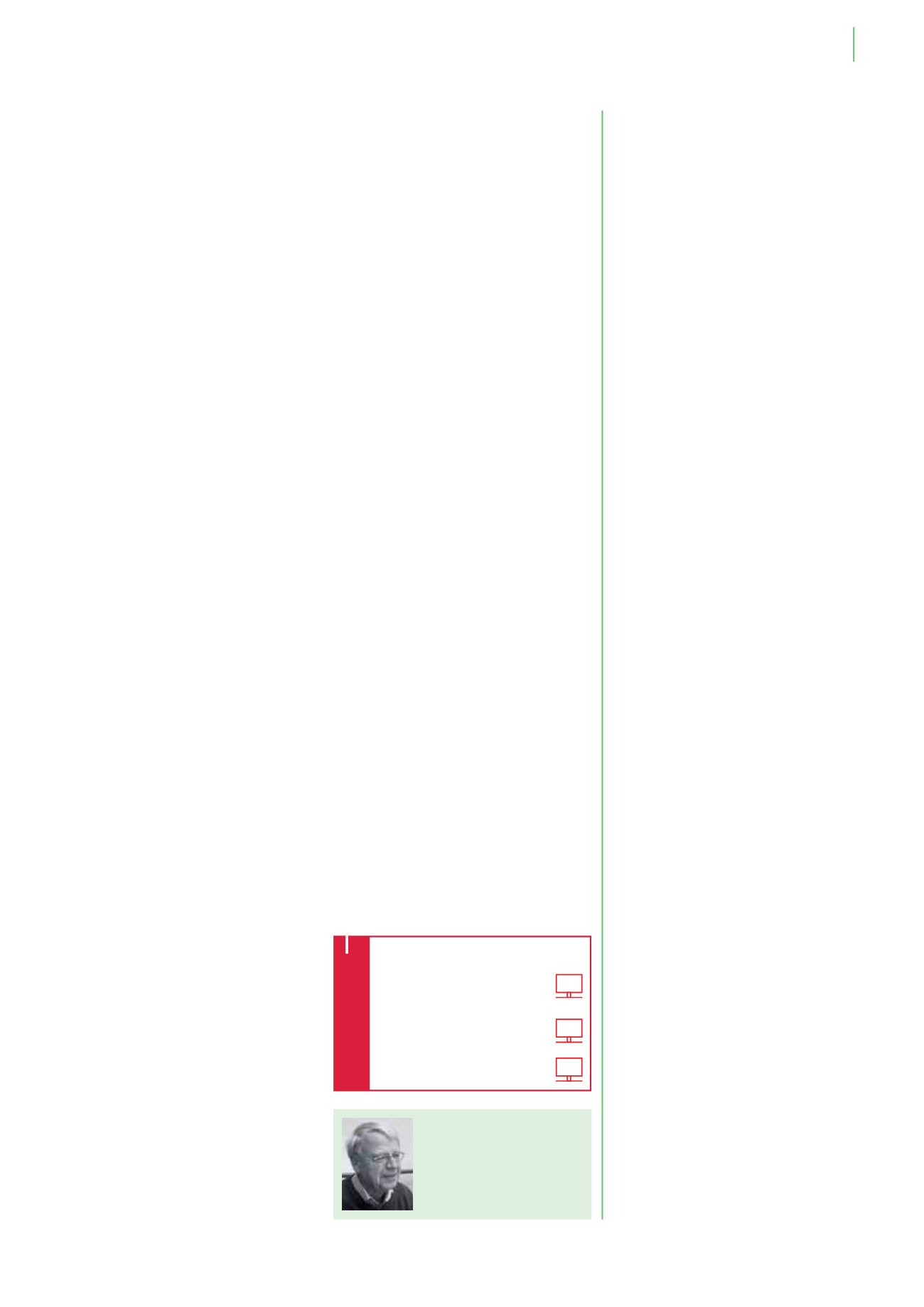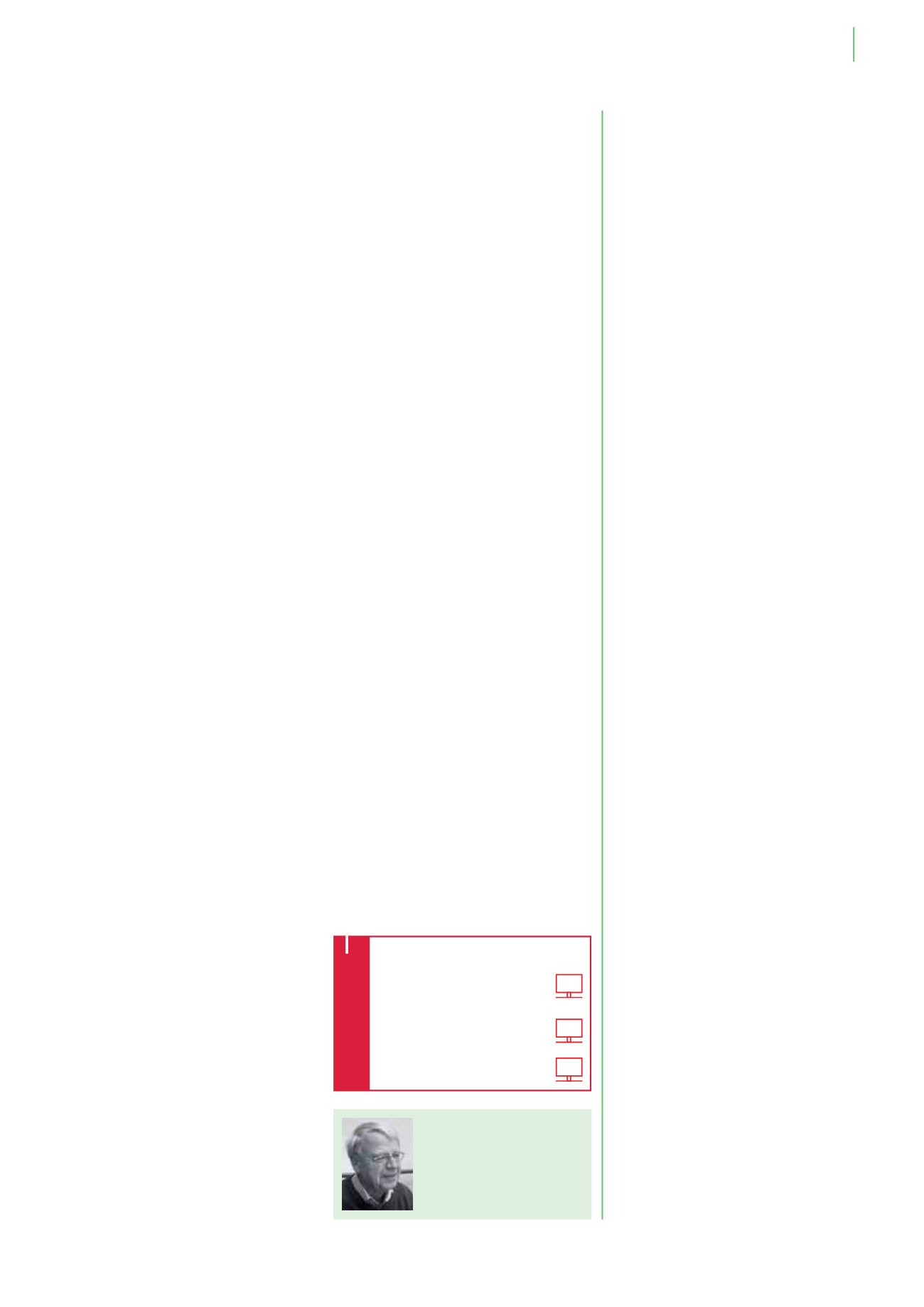
9
nds 11/12-2013
AkademikerInnen verdienen mehr
Seit 2000 geht die Schere zwischen dem
relativen Erwerbseinkommen von Arbeits-
kräften mit Tertiärabschluss im Vergleich zu
jenem der Arbeitskräfte mit Abschluss des
Sekundarbereichs II oder des postsekundären
nichttertiären Bereichs weiter auseinander.
Im Jahr 2000 verdienten Arbeitskräfte mit
Tertiärabschluss etwa 40 Prozent mehr als Per-
sonen ohne diesen Abschluss (OECD-Durch-
schnitt: 49 Prozent mehr). 2011 betrug der
Verdienstvorsprung fast zwei Drittel (OECD-
Durchschnitt: 64 Prozent mehr). Die Erwerbs-
einkommensunterschiede zwischen Personen
mit einem Abschluss des Sekundarbereichs
II oder des postsekundären nichttertiären
Bereichs und Personen mit Tertiärabschluss
steigen mit dem Alter: Während 25- bis
34-Jährige mit hoher Qualifikation 42 Pro-
zent mehr verdienen als ihre Altersgenossen
ohne Hochschulabschluss, können 55- bis
64-jährige Arbeitskräfte mit Tertiärabschluss
damit rechnen, ein doppelt so hohes Gehalt
zu beziehen wie Gleichaltrige, die dieses Bil-
dungsniveau nicht erreicht haben.
AkademikerInnen seltener arbeitslos
Deutschland zählt zu den wenigen Län-
dern, deren Arbeitslosenquote in der jüngsten
Wirtschaftskrise nicht gestiegen ist. Tatsäch-
lich waren die Arbeitslosenquoten der deut-
schen Arbeitskräfte auf allen Bildungsniveaus
zwischen 2008 und 2011 sogar rückläufig.
In den OECD-Ländern haben sich die Ar-
beitslosenquoten unter Erwachsenen ohne
Abschluss des Sekundarbereichs II in diesem
Zeitraum im Durchschnitt von 8,8 Prozent auf
12,6 Prozent erhöht. In Deutschland sind sie
zwar von 16,5 Prozent auf 13,9 Prozent gesun-
ken, verharren aber auf relativ hohem Niveau.
Bei Erwachsenen mit einem Abschluss des
Sekundarbereichs II oder des postsekundären
nichttertiären Bereichs lag die Arbeitslosen-
quote 2011 bei 5,8 Prozent, deutlich geringer
als 2008 mit 7,2 Prozent. Bei den Hochschul-
absolventInnen verringerte sich ebenfalls die
bereits niedrige Arbeitslosenquote in 2008
von 3,3 Prozent auf 2,4 Prozent in 2011.
Akademikerwege
Natürlich braucht Deutschland auch in
Zukunft genügend Auszubildende in Hand-
werk und Handel. Und natürlich müssen
Frühstücksbrötchen nicht von Bäckern mit
Hochschuldiplom gebacken werden. Eine Illu-
sion ist aber die Annahme, dass freie Lehr-
stellen dann besetzt werden könnten, wenn
Studienplätze begrenzt würden. Hier müssen
sich Bund, Länder und Kommunen vielmehr
um die etwa 20 Prozent der sogenannten
RisikoschülerInnen kümmern und diese gezielt
fördern, sodass sie zukünftig über die notwen-
digen Kompetenzen verfügen.
Die derzeit geführte Diskussion über Quo-
tenregelungen, die ein Gleichgewicht zwischen
akademischer und nichtakademischer Ausbil-
dung herstellen sollen, ist nicht zielführend.
Solange AkademikerInnen in Deutschland mit
wachsendem Bedarf auf dem Arbeitsmarkt
gesucht werden und solange Hochschulab-
solventInnen 74 Prozent mehr verdienen als
andere mit niedrigeren Abschlüssen, wird
der Arbeitsmarkt die Nachfrage steuern. Das
wissen auch die jungen Leute und sie orien-
tieren sich deshalb daran. Der ebenfalls für
Beschränkungen plädierende Industrie- und
Handelskammertag muss sich fragen lassen,
warum gerade dort die sonst so gelobten
Marktmechanismen von Angebot und Nach-
frage außer Kraft gesetzt werden sollen.
Wem soll bei beschränkten Plätzen ein
Studium verboten werden? Es wäre kaum
durchsetzbar, die deutlich überrepräsentierten
Kinder aus Akademikerfamilien vom Studium
abzuhalten. Die sowieso schon unterrepräsen-
tierten Jugendlichen aus nichtakademischen
Familien noch stärker vom Studium auszu-
schließen, verstößt jedoch gegen die Grundre-
geln der sozialen Gerechtigkeit. Eher müssen
alle jungen Menschen ermutigt werden, die
Aufnahme eines Studiums ernsthaft zu prüfen.
Die Debatte über die adäquate Akade-
mikerquote ist wesentlich von Dünkel und
Privilegiensicherung geprägt. Die meisten,
die solche Forderungen erheben, reden immer
über die Kinder anderer Leute. Ihre eigenen
Kinder gehen natürlich den akademischen
Weg.
Gerd Möller
Gerd Möller
Mitherausgeber der Zeitschrift
„SchulVerwaltung NRW“ und
Mitarbeiter im Schulministerium
a. D.
Deutsches Zentrum für Hochschul-
und Wissenschaftsforschung:
20. Sozialerhebung
faz.net: Julian Nida-Rümelin
im Gespräch
Deutschlandfunk: Bildungsforscher
Andreas Schleicher im Interview
p us
„Der Bildungsstandort NRW ist blamiert“, ti-
telte die Rheinische Post am 12. Oktober 2013.
Am gleichen Tag las man in der Neuen Ruhr
Zeitung „Note mangelhaft für NRW-Schüler“.
Auf dem Prüfstand
Das Institut zur Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen testete NeuntklässlerInnen in
Mathematik, Biologie, Physik und Chemie. Für
NRW ein vernichtendes Urteil, es wiederholt
sich in regelmäßigen Abständen und lautet
immer gleich. Und nach jedem Mal wird deut-
licher, dass Lerngruppen in NRW mit jenen
in Sachsen nicht wirklich zu vergleichen sind:
Denn schon die soziokulturellen Unterschiede
der Lerngruppen verbietet dies. Neu ist jedoch
die positive Bewertung des DDR-Schulsystems
als Erklärung für das gute Abschneiden der
ostdeutschen Länder! Wer hätte das gedacht?
Man sagt, vom wiederholten Wiegen wird
die Sau nicht fetter. Also was soll das dann?
Wem nützen die Vergleichsstudien? Die Rah-
menbedingungen haben sich kaum verändert,
sie bleiben völlig unzureichend. Die Erwar-
tungen aus der Gesellschaft nehmen immer
weiter zu. Schon Grundschulkinder leiden un-
ter Stress. Wie sollen sich da Lernergebnisse
verbessern? PädagogInnen wissen, dass Men-
schen – SchülerInnen wie LehrerInnen – durch
schlechte Noten und Tadel nicht motiviert wer-
den, und gerade die Motivation ist notwendig,
wenn sich nachhaltig etwas verändern soll.
Aber ist das auch gewünscht? Und wenn ja, in
welche Richtung soll die Veränderung gehen?
Achtung: Stolpergefahr
Eine gesellschaftliche Debatte darüber fin-
det kaum statt. Stattdessen nimmt der Einfluss
der freien Wirtschaft auf Schule und Unterricht
zu. Der Umbau der Bildung ist in vollem Gan-
ge. Entscheidend ist die marktwirtschaftliche
Verwertung. So degenerieren Lernprozesse zum
Training für Tests und zentrale Prüfungen.
Die SchülerInnen müssen dem Weltbild der
Vergleichsstudien angepasst werden und das
bereitet noch Schwierigkeiten!
Fritz Junkers
Jetzt stehen sie wieder in den Medien,
die SchülerInnen aus Nordrhein-West-
falen und ihre Leistungsfähigkeit, die
gerade mal zum Mittelmaß reicht. Mal
wieder schlechter abgeschnitten als
der Süden und der Osten der Republik.
Kommentar
Noch zu retten?