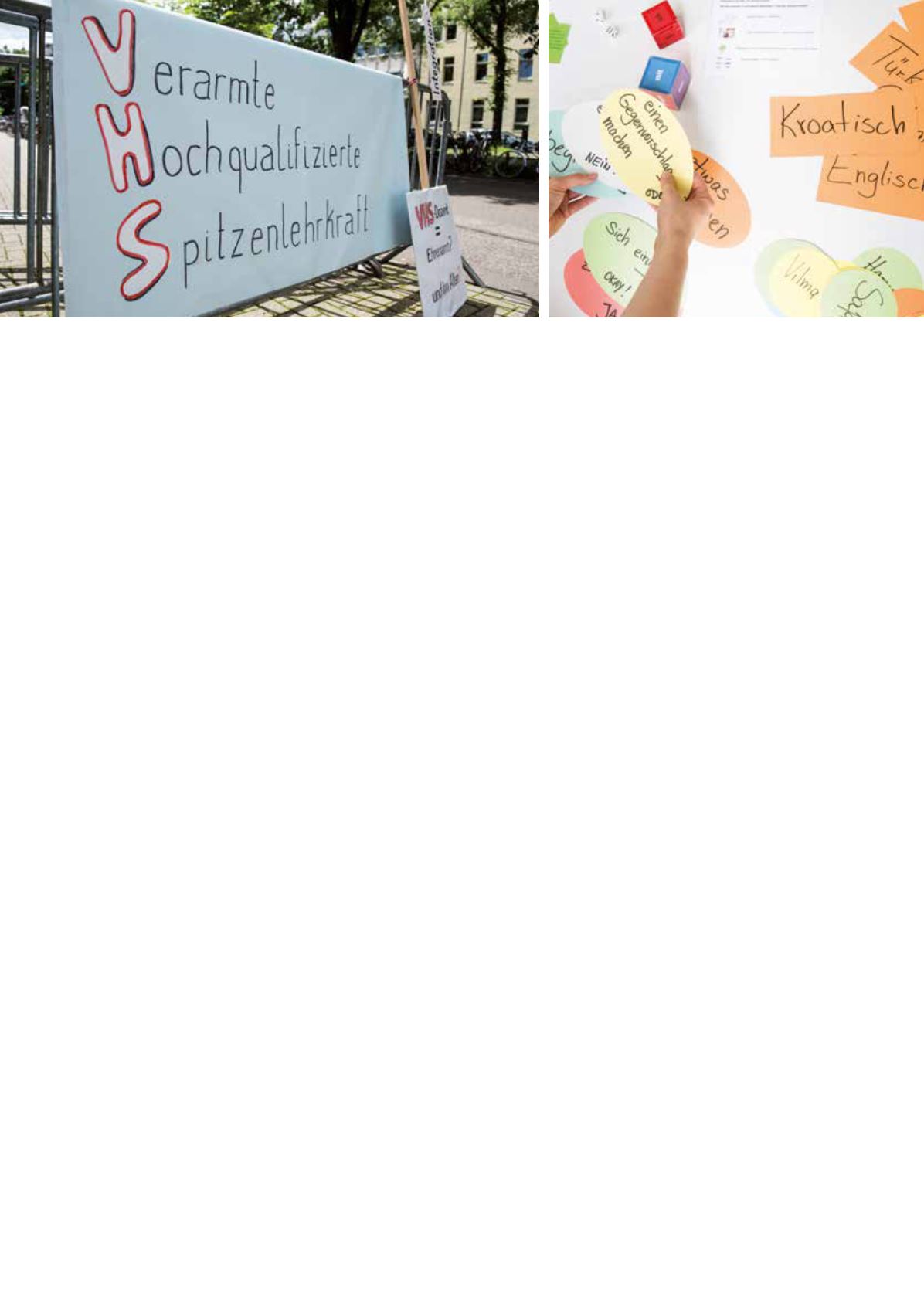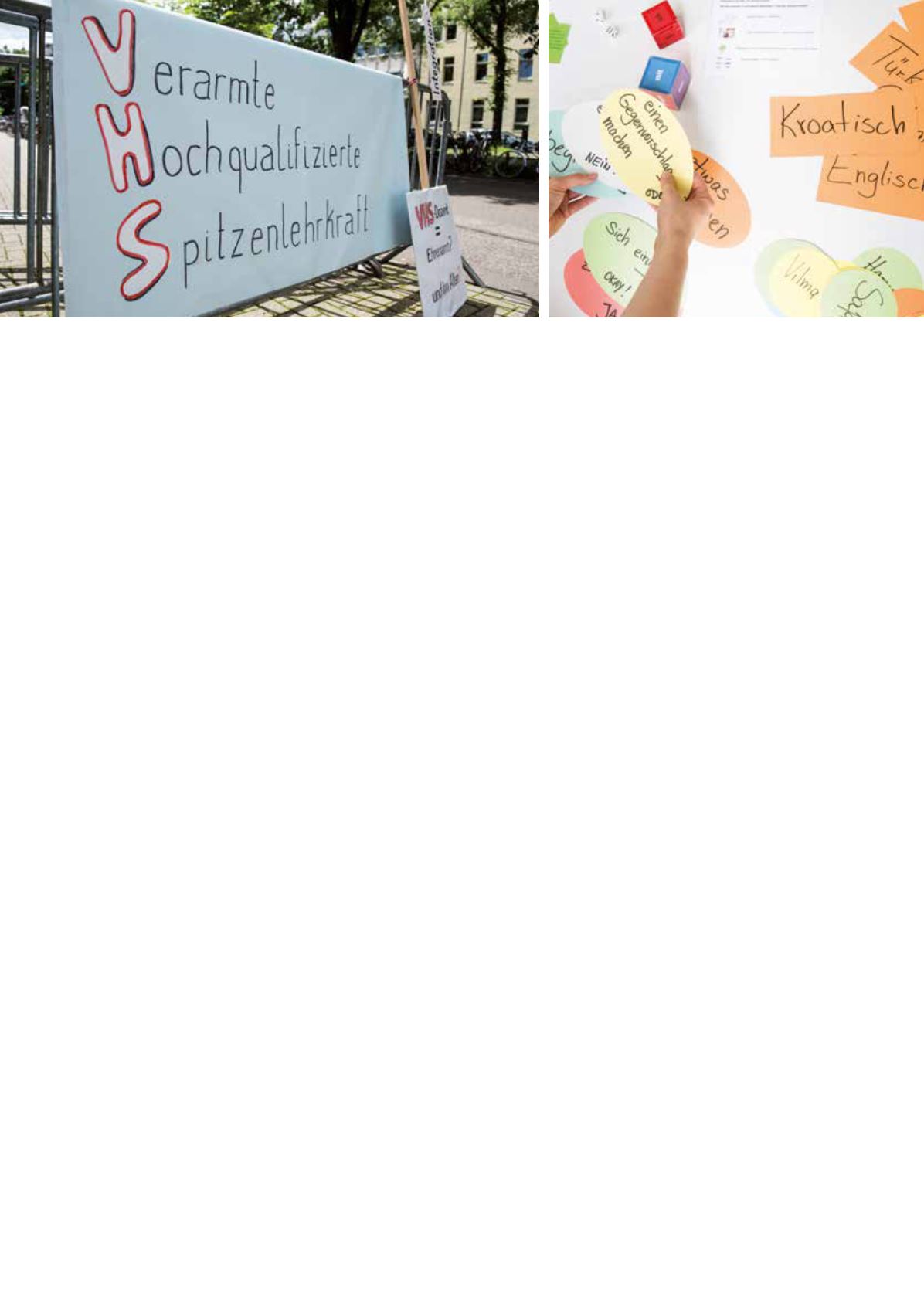
Krankheit, Urlaub, Mutterschutz – was für festangestellte ArbeitnehmerInnen
selbstverständlich ist, kann für Honorarkräfte in der Weiterbildung existenzbe-
drohendwerden.Nachdemneuen IntegrationsgesetzsollenalleGeflüchtetenmit
Bleibeperspektivebeschultwerden.DochwerübernimmtdieseAufgabeaufBasis
der aktuellenHonorarverträge?Diends sprachmit zwei Lehrkräftenund einem
Gewerkschafter über die prekäre Situationder BeschäftigtenunddieChancen.
Weiterbildung
Fachkompetenz verdient Anerkennung
DozentinAngelikaBöhrermacht imGespräch
immerwiederdeutlich,wiesehrsiesichAnerken-
nung für ihregeleisteteArbeitwünscht. Primär
inmonetärer Form, aber auchdurchdieAufhe-
bungder strukturellenMissachtung vonBund,
LandundKommunegegenüber freiberuflichen
LehrerInnen imWeiterbildungssektor. „Undzwar
nichtnurausdermomentanenEinsichtheraus,
dass junge LehrerInnennicht bereit sindunter
solchen Bedingungen zu arbeiten. Auch aus
GerechtigkeitgegenüberdenKollegInnen,denen
seit JahrzehntenGeld vorenthaltenwurde.“
Sie und ihr Kollege Klaus Mautsch unter-
richten Deutsch an der Volkshochschule in
Köln. Als EinzelunternehmerInnenarbeiten sie
selbstständigundbeziehendafür einHonorar.
IhrStatusentsprichtnichtdemvonLehrkräften
aus dem Regelschulsystem, was sich auch in
der Entlohnung niederschlägt. Sie sind selbst
und in vollem Umfang kranken-, pflege- und
rentenversicherungspflichtig.Hinzukommendie
VersicherunggegenErwerbslosigkeit,Berufshaft-
pflichtundKrankentagegeld.Wirtschaftlich ist
dasnicht. Verdienteine freiberuflicheLehrkraft
mehr als 5.400,- Euro im Jahr, fließen 18,7
Prozent davon in die gesetzliche Rentenkasse
ein. Sie profitieren nicht wie LehrerInnen im
Regelschulbetriebdavon, dassderArbeitgeber
dieHälfte der Versicherungsbeiträge zahlt.
ImJahr2015unterrichteteAngelikaBöhrer27
Wochenstunden,dieVor-undNachbereitungszeit
derStundennichtmiteingerechnet. IhrHonorar
betrug21,- Euro, indiesem Jahr sindes23,- Euro
pro Stunde. Nach Abzug aller Steuern beläuft
sich ihr monatlicher Nettoverdienst auf etwas
über 1.000,- Euro.
Selbständigeohne Lobby
Um die Öffentlichkeit über die Arbeitsbe-
dingungen zu informieren und eine bessere
Vernetzung der Lehrkräfte zu gewährleisten,
starteteAngelikaBöhrer zusammenmit Kolle-
gInnenKreidefresser.org, eineWebsite, dieauf
dieprekäreSituationderLehrkräfteaufmerksam
macht, deren Forderungen klar darlegt und
mediale Berichterstattung dokumentiert.
WasLehrkräfte inSprach-und Integrationsklas-
sen leistenmüssen, ist einekomplexeAufgabe.
Sie vermitteln Deutschlernenden sprachliches
und landeskundliches Wissen, bieten ihnen
einen differenzierten Einblick in die deutsche
Sprache und Kultur und helfen, das interkul-
turelle Verständnis zu fördern. Dabei treffen
sie auf eine heterogene Zielgruppe, die sich in
ihrerHerkunftsspracheunterscheidet und sich
in der Zielsprache noch nicht verständigen
kann.Dasheißt, alleKommunikation läuft von
Anfang an ausschließlich über die Lehrenden.
FremdsprachenlehrerInnenandeutschenRegel-
schulenkönnenbeiRatlosigkeitderSchülerInnen
jederzeit auf Deutsch umschwenken. Diese
Möglichkeit haben DozentInnen, die Deutsch
als Zweitsprache unterrichten, nicht. Die Kurs-
teilnehmerInnensindsowohlkulturellundgesell-
schaftlichals auch vom Standder Bildungher
höchstunterschiedlichsozialisiert.Divergierende
Lernvoraussetzungen und -traditionen treffen
auf Faktorenwie Alter, Bleibeperspektive, per-
sönliches Engagement – und auch die Frage,
ob die Teilnahme freiwillig oder verpflichtend
geschieht.
Max-GeorgBeier, Sprecher fürWeiterbildung
imVorstanddesGEW-StadtverbandsKöln,bringt
esauf denPunkt: „DieLehrerInnen sindoftdie
ersten, mit denen die EinwanderInnen ohne
behördlichen Hintergrund wertfrei reden. Sie
begleitenMenschenaufdemWeg ineinneues
Leben und sind LehrerInnen, Beratungs- und
Vertrauenspersonen in einem.“ So bespricht
Angelika Böhrer abseits des Unterrichts auch
Briefe vom Jobcenter, währendKlausMautsch
mit seinenSchülerInnenBewerbungsschreiben
verfasst.
KompetenzbrauchtWertschätzung
„Wenn Medien über Integrationskurse be-
richten, wird oft ein falsches Bild vermittelt“,
mahntAngelikaBöhrer. „Natürlichsinddievielen
Ehrenamtlichen, dievorallemmitGeflüchteten
arbeiten, eineHilfe,wennesumdieersteEinfüh-
rung indie Sprachegeht, aberwir habendafür
studiertund spezielleWeiterbildungenbesucht.
Es ist die eine Sache sagen zu können ‚Das ist
falsch.‘ und eine andere, die Begründungmit-
zuliefern.“Zeitungsartikel oderFernsehberichte,
in denen eine Tafel gezeigt wird, auf der „das
Auto“ steht,werdenderkomplexenAufgabeder
studierten Lehrkräfte nicht gerecht.
Neben den vielen neuen Integrationskurs-
TeilnehmerInnen gab und gibt es andere, die
aufprofessionellenUnterrichtangewiesensind,
„Nicht jeder der Deutsch
sprechen kann, kann auch
Deutsch unterrichten.“