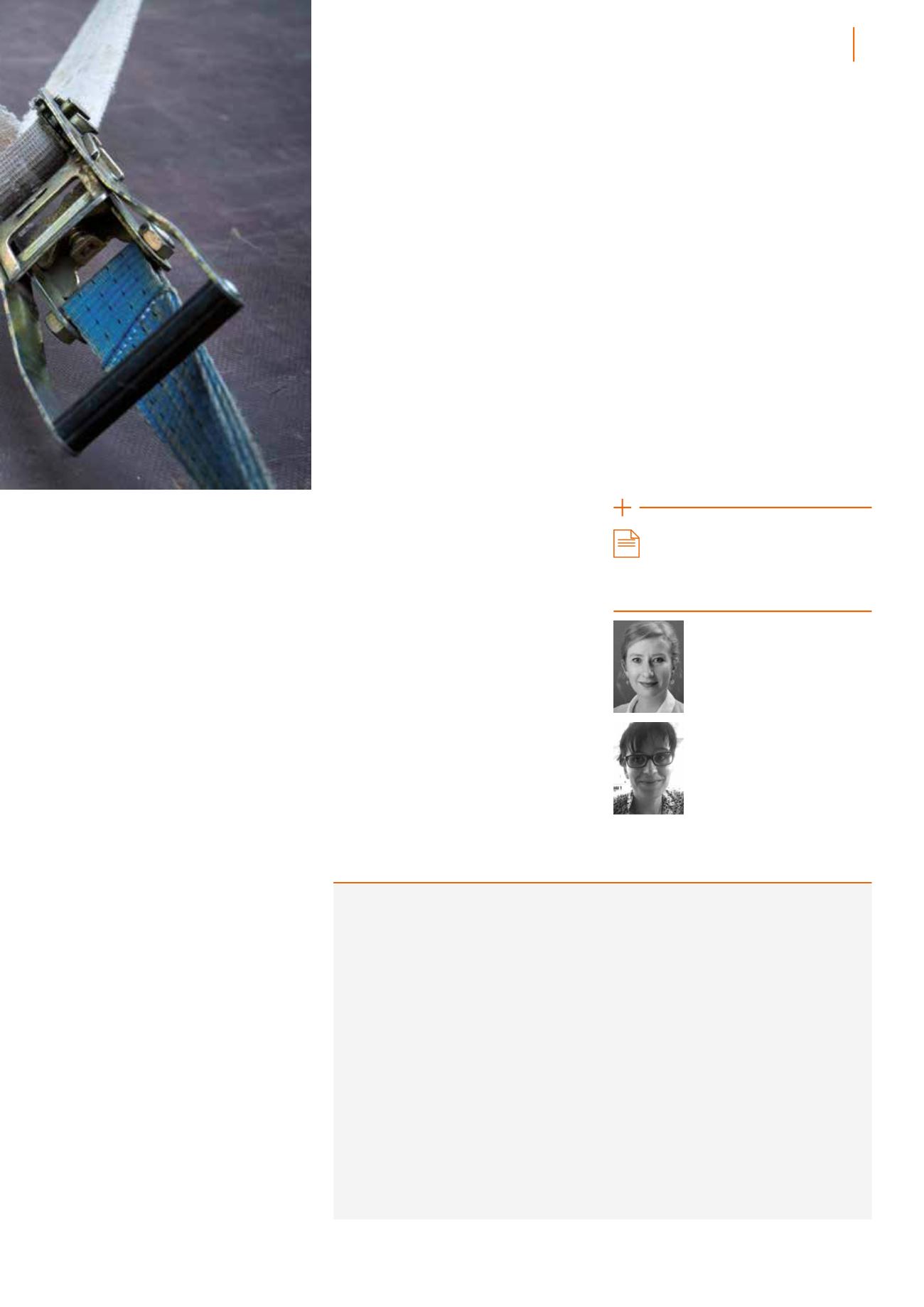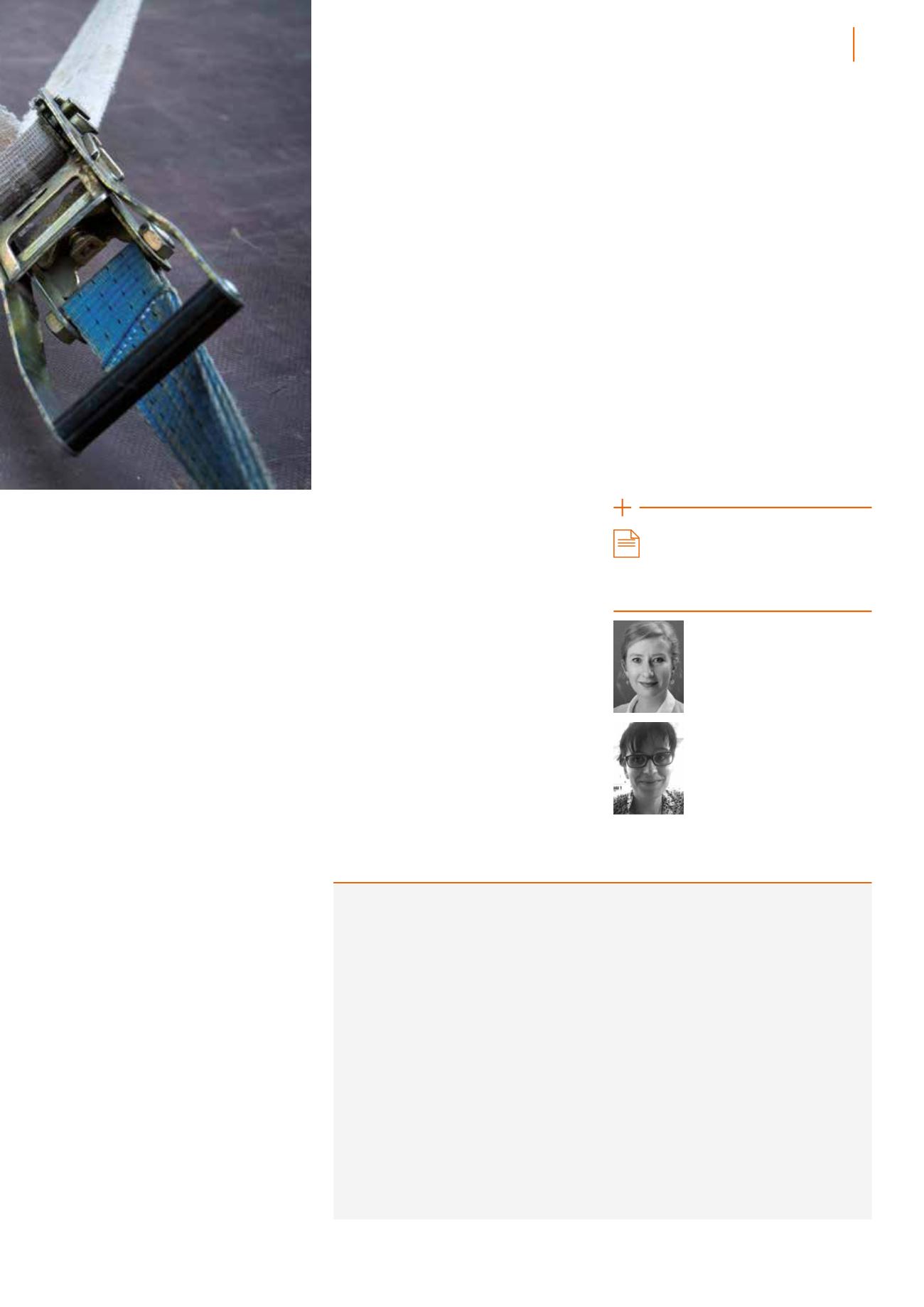
21
nds 6/7-2016
DieTrägerwiederumhabenkeinegarantierte
Finanzierung, ein Teil hängt von einem freiwil-
ligenAnteil der Stadt ab, der immer wechseln
kann. Das verschärft die ohnehinmassiveUn-
terfinanzierungdesGanztags, die inder Politik
übrigens zugleich bekannt ist und bedauert
wird.DasGeld füreine tatsächlichausreichende
Finanzierung dieses Bildungsbereichs sei je-
doch nicht vorhanden. So bleibt es bei einem
permanenten Krisenmanagement für Träger
undMitarbeiterInnen. Träger, die einen etwas
höheren Stundenlohn bezahlen, müssen die
KostenanandererStellewiedereinsparen. Zum
Beispiel bei der Anzahl der MitarbeiterInnen,
beiderAngebots- undEinrichtungsausstattung
oder durchweniger Öffnungstage.
Zusätzlich erhöht sichderDruck auf die Trä-
ger dadurch, dass die Kooperationsverträge
mit Schulen jeweils nur ein Jahr andauernund
dann neu verhandelt werden können. So ha-
ben Schulen die Möglichkeit, sich für Träger
zu entscheiden, die möglichst viele Angebote
undMitarbeiterInnen stellen – auf Kostendes
LohnsderOGS-MitarbeiterInnen.HateineSchule
den Eindruck, der Offene Ganztag läuft nicht
rund, kann sie die Kooperation beenden. Die
Trägerwerdendadurcherpressbar, habenkeine
gleichberechtigte Verhandlungsposition für
eineMitbestimmungund sindgezwungen, die
Betreuung trotz desaströser finanzieller Aus-
stattung am Laufen zu halten. Ein Druck, der
nicht seltenunfreiwilligandieMitarbeiterInnen
weitergegebenwird. EinkritischesHinterfragen
der Arbeitsverhältnisse bringt Träger häufig in
einen Interessenkonflikt zwischenKooperations-
partnerInnen undMitarbeiterInnen.
SandraHerbst
Diplom-Pädagogin, OGS-Leitung und
Betriebsrätin
Mitbestimmung ermöglichen
undAnerkennung zeigen
Küchenausstattung,Reinigungszeiten,Haus-
meisterzuständigkeit wurden in den meisten
SchulennichtandieExistenzdesOffenenGanz-
tagsangepasst.MangelndeRäumlichkeitenund
fehlendeAusstattung, teilschaotischeArbeitsbe-
dingungensindAlltagund lasseneinegesetzlich
verankerte Struktur vermissen. Hier wurde ein
Dauerprovisoriumgeschaffen.Anlässe, sich für
die eigenen Interessen starkzumachen, gibt es
also genug. Wie dieMitbestimmungsmöglich-
keiten der OGS-MitarbeiterInnen ausgestaltet
sind, hängt jedoch von der Einstellung der
Schulleitung ab. PädagogInnen im Offenen
GanztagkönnenkaumDruckdurchStreik aus-
übenwie zumBeispiel Kita-Beschäftigte, denn
bei vielen Trägern gibt es keine Tarifbindung
und dementsprechend auch keine Tariferhö-
hungen. FürmancheMitarbeiterInnenhat sich
ihr Lohn seit Beginn der OGS nicht verändert.
Sie blieben über viele Jahre bei dem Gehalt
von BerufsanfängerInnen hängen, das zudem
von vornhereinweit unter dem Tarif liegt und
bei dem es keinerlei Erhöhungen im Laufe der
Jahre gibt.
Auch auf Ebene der sozialen Anerkennung
gibtes kaumGleichberechtigung.Häufigwerden
OGS-MitarbeiterInnenvomPersonalderSchulen
zwar alswillkommeneUnterstützunggesehen,
nicht aber als gleichwertige PädagogInnen.
Dies ist mitunter auch dem Fakt geschuldet,
dass die finanziellen Mittel ausschließlich in
die Quantität und nicht in die Qualität des
OffenenGanztags geflossen sind. Vor allem in
Großstädten istdieNachfrageanGanztagsplät-
zen enorm angestiegen, was zu einem rasant
schnellen Ausbau des Angebots geführt hat,
währendqualitative Standards auf der Strecke
geblieben sind.
UmdieArbeit inderOGSnichtnuraufrecht-
erhalten zu können, sondern auch um dabei
den gestiegenen pädagogischen Ansprüchen
gerecht zuwerden, braucht es eine Tarifbezah-
lungderPädagogInnen,eineGesetzesgrundlage
speziell für den Offenen Ganztag, gesetzliche
Qualitätsstandards, eineausreichendeStunden-
anzahl, den Ausbau von Räumlichkeiten, eine
ausreichende Finanzierung für Ausstattung
sowie einen angemessenen Personalschlüssel.
AufdieseWeisekönnenauchdieBeschäftigten
endlich die Wertschätzung erfahren, die ihre
Arbeit seit nunmehr 13 Jahren verdient.
//
SybilleMelanie Flint
Erzieherin und langjährigeGruppen-
leitung, aktuell freigestellte Betriebs-
rätin bei einem großenKölner Träger
AusdemAufgabenspektrum
vonOGS-Beschäftigten
Zusammenführung und Anleitung einer bis zu 30
Kinder starkenGruppemit unterschiedlichengesell-
schaftlichen, sozialenund religiösenHintergründen
//
AnleitungdesGruppenalltagsmitEssen,Hausaufga-
ben,AusflügenundAngeboten
//
Wochenplanung
//
intensiveBetreuung von Inklusionsprozessen
//
Erar-
beitung und Durchführung von Bildungsprojekten
und sozialem Lernen
//
Analyse von soziokulturellen
Hintergründen und gruppendynamischen Prozes-
sen
//
Erarbeitung von langfristigen Projekten als
Bildungseinrichtung nach dem Leitbild des Trägers
undderKonzeptionderEinrichtung
//
Förderungvon
Selbstwert, PartizipationundSelbstständigkeit jedes
einzelnenKindes
//
Präventionsarbeit
//
Kinderfalldo-
kumentation
//
LeitungvonElternsprechtagen
//
Eltern-
gespräche und Zielvereinbarungen
//
Ausarbeitung
vonFörderplänenundEntwicklungsdokumentation
//
Planung, KoordinierungundDurchführung vonAGs
und Ferienangeboten
//
Teamsitzungen
//
Super-
vision
//
Fortbildungen
//
Arbeitskreise
//
Kinderfallbe-
sprechungen
//
Personalverantwortung
//
permanente
Wachsamkeit undAnsprechbarkeit
//
Austauschmit
LehrerInnen, SchulsozialarbeiterInnen, Jugendamt,
TherapeutInnen, FamilienhelferInnen, Inklusionshel-
ferInnen und Eltern
GesonderteVorbereitungszeit istfürdieseAufgaben
nicht vorgesehen. In der Regel wird deshalb ein
großer Teil derVorbereitungwährendderpädago-
gischen Arbeit und Aufsicht der Kinder erledigt,
da bei der geringen Stundenzahl wenig bis keine
Ressourcendafür bleiben.
Fotos: time., prokop/photocase.de