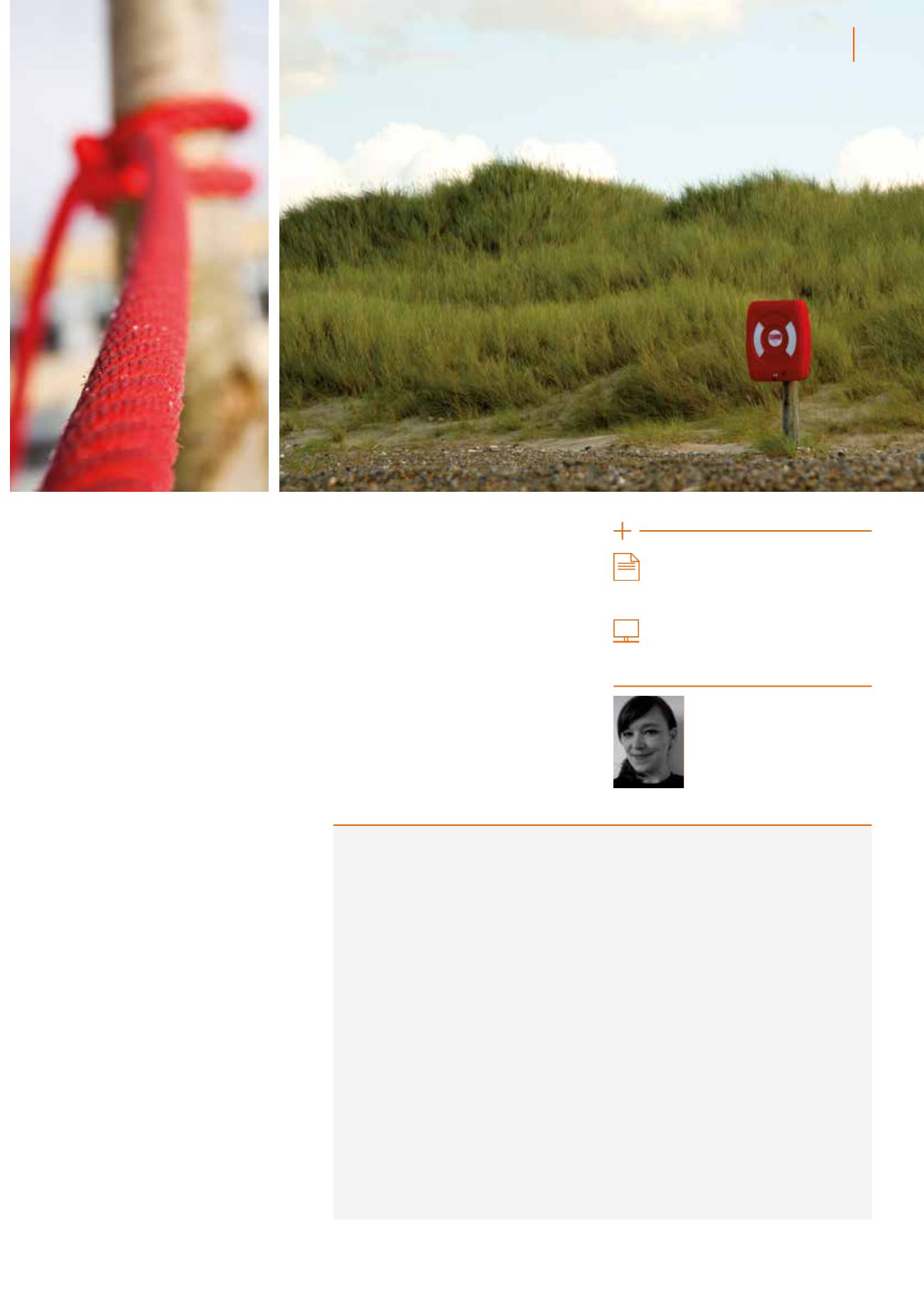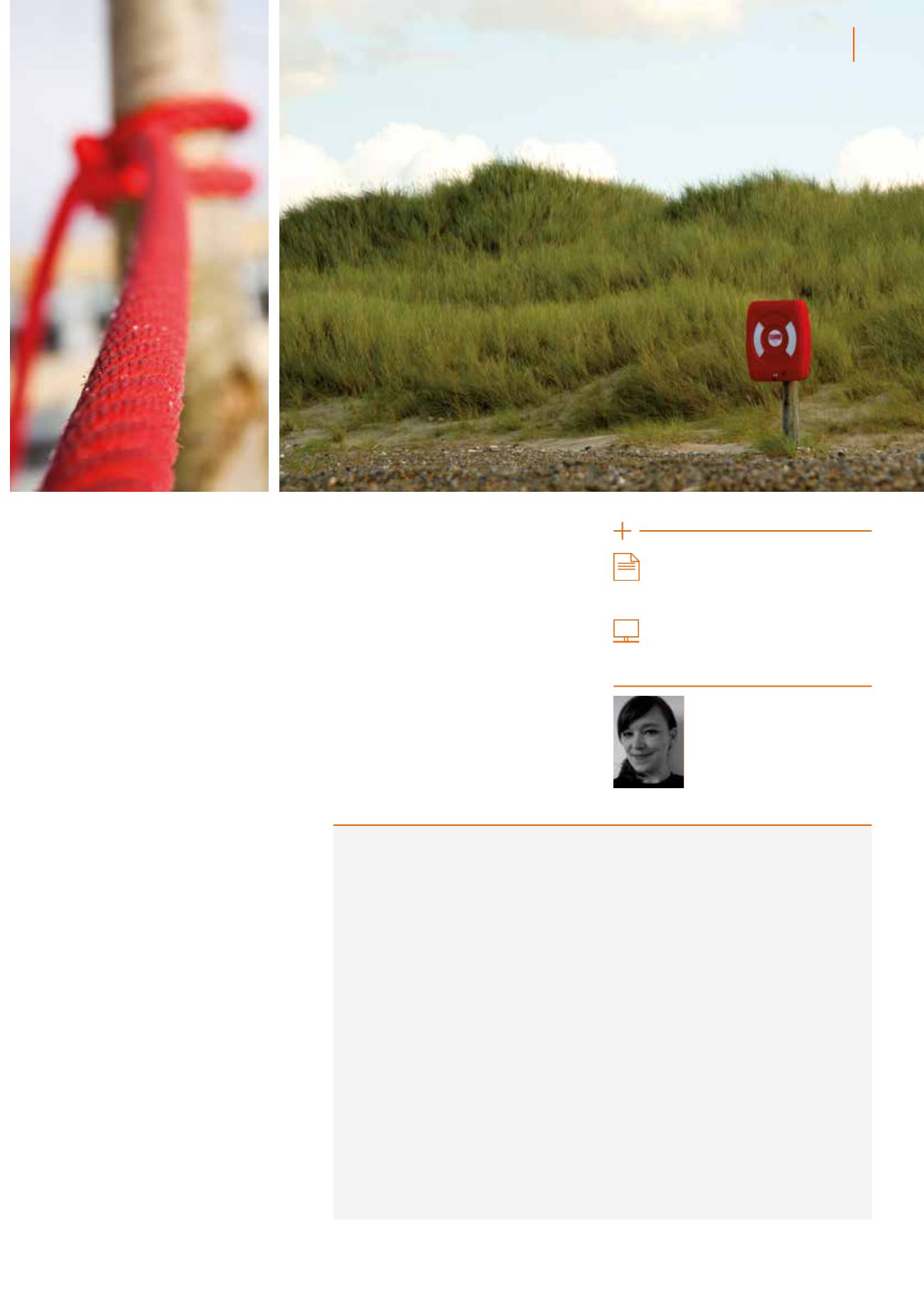
19
nds 6/7-2016
-
BarbaraUmrath
LandesfachgruppenausschussHoch-
schule und Forschung, Doktorandin
und befristet beschäftigtewissen-
schaftlicheMitarbeiterin
PromotionoderHabilitationbenötigtenZeiten
zurück. Inwiefern die imMärz 2016 in Kraft
getretene Novelle des WissZeitVG mit seiner
Formulierung,dieVertragslaufzeitensollendem
Qualifizierungsziel „angemessen“ sein, für eine
Veränderungsorgt,musssicherstnoch inderPra-
xis zeigen. InalldenFällen, indeneneineStelle
zumehr als50Prozent aus denMittelnDritter
finanziert wird, sind befristete Arbeitsverträge
zudemweiterhin über die 6-plus-6-Jahre-Regel
hinaus zulässig.
UnsicherePerspektiven
undEinzelkämpferInnentum
Mit Blick auf das Einkommen können tarif-
vertraglichgeregeltewissenschaftlicheArbeits-
verhältnisse nicht als prekär gelten. Allerdings
werdenDoktorandInnengerneauf50-Prozent-
Stellen eingestellt – und promovieren damit
überwiegend unentgeltlich in ihrer Freizeit.
Finanziell prekär wird dies, wenn Arbeitslosig-
keit eintritt, dader Anspruch auf Arbeitslosen-
geld dann deutlich unter 1.000,- Euro liegt.
Der hohe Anteil an Befristungen bedeutet für
diewissenschaftlichBeschäftigtenzugleichdas
Fehlen einer auch nur halbwegs verlässlichen
Zukunftsperspektive. WissenschaftlerInnen
wird ein hohes Maß an Mobilität abverlangt,
das sichnur bedingtmit dauerhaften sozialen
BeziehungenoderderWahrnehmungvonFami-
lien-undPflegeverantwortungvereinbaren lässt.
AndiesemgrundlegendenProblemänderndie
familien- und pflegepolitischen Komponenten
des WissZeitVG, die eine Verlängerung von
Höchstbefristungsdauern und Verträgen er-
möglichen, nichts.
Die gewerkschaftliche Organisierung und
kollektive Interessenvertretung der Beschäf-
tigten trifft in diesem Bildungsbereich auf ein
besonderesHindernis, das inderherrschenden
Logik des Wissenschaftssystems liegt: Wissen-
schaftliche Erkenntnisse müssen einzelnen In-
dividuen zurechenbar sein,womitKooperation
undForschungsverbündehäufignurMittel zum
Zweck sind. Dass die eigene Arbeit von den
meistenWissenschaftlerInnenals sehrbefriedi-
genderlebtwirdundzudemprestigeträchtig ist,
tröstet derzeit noch vieledarüber hinweg, dass
dieBedingungen, unterdenendieseerfolgt, ein
unbefriedigend verdient haben.
//
Promotionsstipendien
Einprekärer Sonderfall
Ein Stipendium während der Promotion scheint
die Lösung vieler Probleme zu sein, denn die Pro-
motion erfordert in der Regel vollen Arbeitsein-
satz. Doch auf längere Sicht ergeben sich Nach-
teile für die jungenWissenschaftlerInnen.
Rund 4.100 Promovierende erhalten derzeit ein
Stipendium von einem der 13 Begabtenförderungs-
werke. Im Zuge der Einrichtung von Graduierten-
schulen und -kollegs treten aber auch immer mehr
Hochschulen als Stipendiengeber auf. Einheitliche
Regelungen gibt es jedoch nicht: Während die Sti-
pendiatInnen der Begabtenförderungswerke einen
einheitlichen Satz von aktuell monatlich 1.150,-
Euro zuzüglich einer Forschungskostenpauschale
von 100,- Euro erhalten, variiert die Höhe des
Stipendiums, wenn Hochschulen selbst Stipendien-
geber sind.
Mit einem Stipendiumwird zudem kein Arbeitsver-
hältnis begründet, sodass angehendeWissenschaft-
lerInnen damit außerhalb der Sozialversicherungs-
systeme stehen.Wer drei Jahre – so langebeträgt in
der Regel die Höchstförderdauer – mit Stipendium
promoviert, zahlt währenddessen nicht in die ge-
setzliche Rente ein undmuss darüber hinaus selbst
für Kranken- und Pflegeversicherung aufkommen.
Für den Vollzeitjob, den die Promotion meist dar-
stellt, stehen StipendiatInnen der Begabtenförde-
rungswerke so faktisch gut 1.000,- Euro monatlich
zur Verfügung – angesichts der Mietspiegel in den
meisten Universitätsstädten ein nicht gerade üp-
piges Auskommen.
Ein weiterer Nachteil ergibt sich bei späteren
Arbeitsverträgen. Der Tarifvertrag sieht die An-
rechnung von Promotionszeiten, die keine Be-
schäftigungszeiten sind, nicht als berufliche
Vorerfahrungszeiten an. Das führt dazu, dass pro-
movierte WissenschaftlerInnen nicht selten als Be-
rufsanfängerInnen eingruppiert werden.
Fotos: DWerner, gennadi+/photocase.de