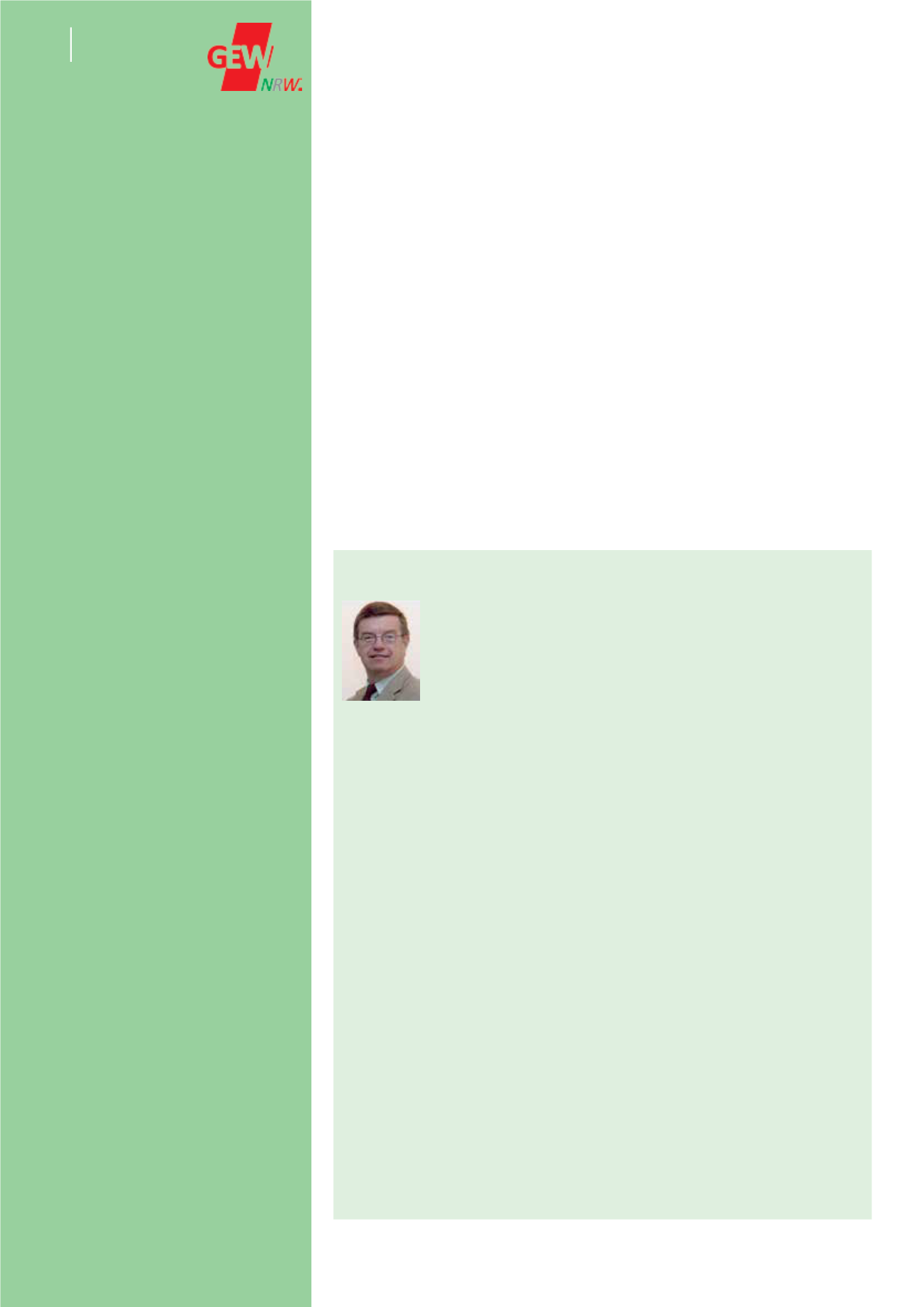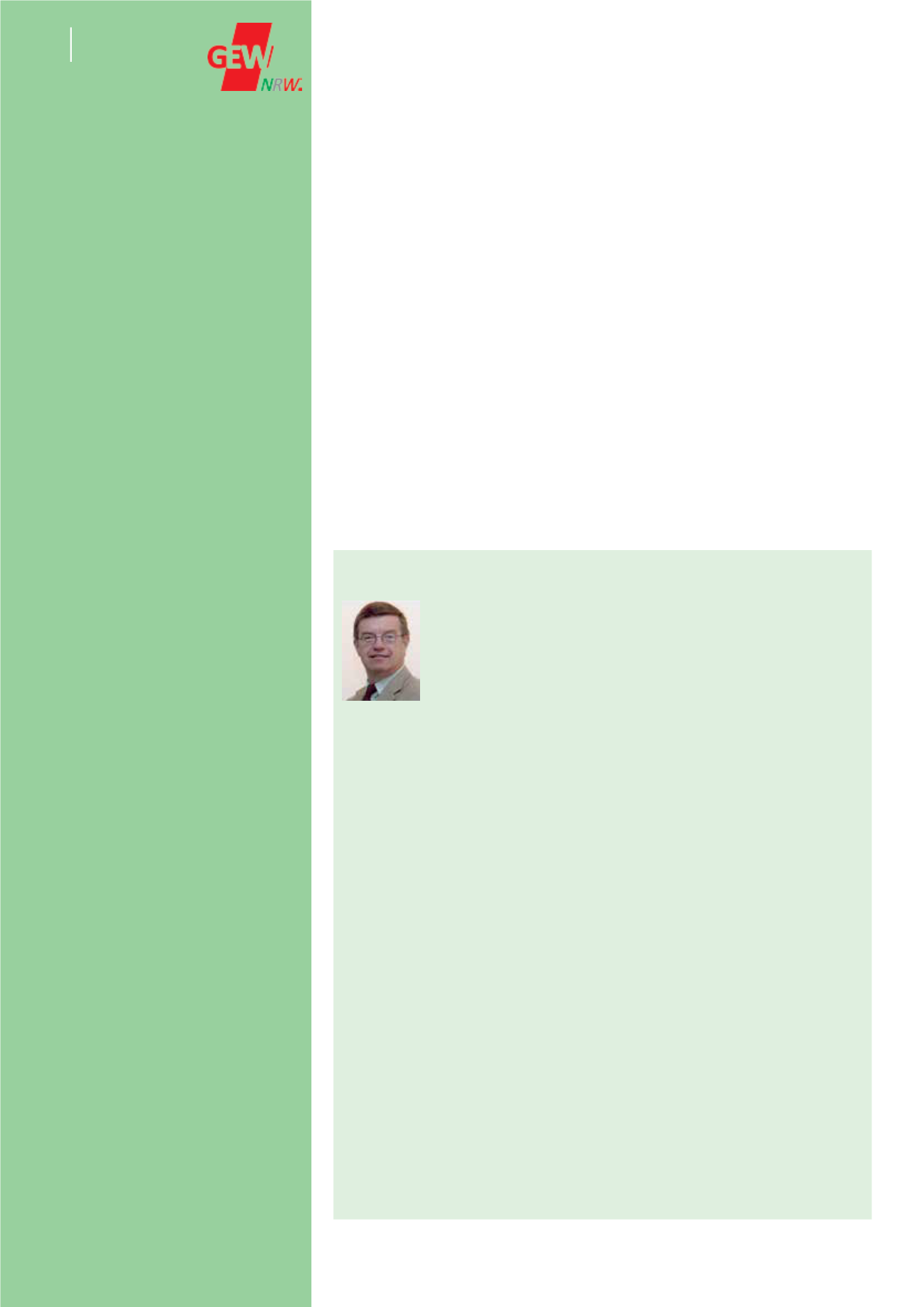
Vorbereitungen auf den großen Inklusionskongress
Information und Austausch
Die GEW NRW unterstützt die Inklusion,
kritisiert jedoch die mangelnde Steuerung des
Inklusionsprozesses und die unzureichenden
Ressourcen, die dafür zur Verfügung gestellt
werden. Viele Lehrkräfte fühlen sich außerdem
nicht ausreichend vorbereitet. In Kooperation
mit dem DGB Bezirk Nordrhein-Westfalen
findet am 27. Mai 2014 der erste Inklusions-
kongress der GEW NRW in Oberhausen statt.
Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz
zur Umsetzung der Inklusion in Nord-
rhein-Westfalen tritt im Schuljahr
2014/2015 in Kraft und stellt viele
Schulen bereits jetzt vor große He-
rausforderungen.
Damit bietet die Bildungsgewerkschaft Lehr-
kräften eine Plattform, um sich über den aktu-
ellen Stand und die Gelingensbedingungen der
Inklusion zu informieren, um Anregungen für
den Unterricht zu erhalten, aber auch, um ihre
Probleme, Kritik und Sorgen zum Ausdruck zu
bringen. Dazu sind viele ExpertInnen vor Ort,
die in unterschiedlichen Foren und an Infostän-
den die Aspekte der Inklusion ansprechen.
Nach Schulministerin Sylvia Löhrmann, die
den Kongress mit einem Vortrag über den
aktuellen Stand eröffnen wird, wird Prof. Dr.
Matthias von Saldern das zweite Hauptreferat
des Tages halten. Der Erziehungswissenschaft-
ler beantwortete im Vorfeld drei Fragen zum
Thema.
Ilse Führer-Lehner
Nachgefragt
nds: Was wird sich mit dem 9. Schulrechtsände-
rungsgesetz in NRW verändern und wie lange
wird der Umsetzungsprozess dauern?
Matthias von Saldern:
Langfristig werden wir es
schaffen, 80 Prozent der Kinder mit sonderpäda-
gogischer Förderung in einer Regelschule zu un-
terrichten. Außerhalb der Bundesgrenzen zeigen
die Länder, dass es möglich ist. Allerdings sind
dies zwei ungleichzeitige Prozesse: Das einzelne
Kind wird die neue Regelung sofort in Anspruch
nehmen können. Für sie ist das Gesetz daher ein
Segen. Die bisherigen Regelungen waren oft
demütigend und frustrierend. Doch man muss
auch ganz klar sehen, dass die Umstellung des
gesamten Systems zehn bis 15 Jahre in Anspruch
nehmen wird. Wir haben es dann geschafft, wenn
wir den Begriff Inklusion nicht mehr brauchen.
Wie gelingt die Umsetzung der Inklusion im
laufenden Betrieb Schule?
Zur Implementation der Inklusion gibt es keine
empirischen Untersuchungen. Es liegen aber Er-
fahrungen von außerordentlich erfolgreichen Mo-
dellversuchen zur Integration vor. Sie sollten als
Maßstab genommen werden. Schulen arbeiten
in anderen Bereichen schon längst inklusiv. So
schließen KlassenlehrerInnen heute SchülerInnen
nicht aus, nur weil sie die fünf Euro für den Wan-
dertag nicht haben. Man besorgt sich das Geld
woanders, damit diese SchülerInnen teilhaben
können. Das ist gelebte Inklusion.
Gute Schulen finden pfiffige Lösungen. So wird
man ein Kind mit sonderpädagogischem För-
derbedarf nicht in eine Klasse setzen, in der es
viele hochbegabte SchülerInnen gibt oder solche,
die ADHS oder Verhaltensschwierigkeiten haben.
Man wird auch schulintern klären, welche Lehr-
kräfte nach welchen Fortbildungen in welchem
Zeitraum in welchen besonders ausgestatteten
Klassenräumen Unterricht halten, in denen es
auch förderbedürftige Kinder gibt. Es gilt also vor
Ort, den Herausforderungen intelligent zu begeg-
nen. Man kann Kollegien auch dadurch entlasten,
dass der Schulträger mehr personale Ressourcen
in anderen Bereichen zur Verfügung stellt. Solche
Kommunen gibt es – auch und gerade in NRW.
Aus Sicht der GEW reichen die vorgesehenen
Ressourcen sowie die Unterstützung nicht aus.
Wie schätzen Sie die Regierungspläne ein?
In NRW und anderswo ist die Inklusion noch gar
nicht im Gesetz verankert. Das ist Integration
Plus, aber nicht Inklusion. Man versucht, mit alten
Steuerungs- und Finanzierungsregeln Inklusion
umzusetzen. Diese Herangehensweise ist teuer.
Man muss ein inklusives System völlig neu den-
ken. Dazu gehört beispielsweise eine komplett
neue Lehrerausbildung. Die Universität Potsdam
ist hier Vorreiter. Hinzu kommt, dass Sonderpäda-
gogInnen neben der Individualförderung andere
Aufgaben bekommen – wie Systemberatung oder
Hochbegabtendiagnostik. Die Ministerien sollten
alle Ressourcen, die Förderung betreffen, zusam-
menfassen. So ist zum Beispiel die Trennung der
Hochbegabtenförderung und der Förderung von
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
unsinnig. Dennoch benötigt man vor allem in
der Übergangsphase erheblich mehr Ressourcen.
Letztlich wird man sich auch über Schulstruk-
turen unterhalten müssen: Die Einteilung der
SchülerInnen nach Klasse vier widerspricht dem
Inklusionsgedanken und macht Bildungswege
unnötig kompliziert.
Prof. Dr. Matthias von Saldern
ist Erziehungswissenschaftler der
Leuphana Universität
Lüneburg
Unterstützung beim Genderbericht
Wir gendern
das!
Der Gewerkschaftstag hat 2013 be-
schlossen, dass der Landesvorstand
einen Genderbericht in Auftrag gibt
und eine Kommission einrichtet. Al-
les ist vorbereitet: Jetzt sind die Un-
tergliederungen gefragt.
Der Genderbericht soll neben der Analyse
der Umsetzung von Gender-Mainstreaming
als Politikkonzept der Organisationsentwick-
lung vor allem Handlungsoptionen für den
Generationenwechsel in der GEW entwickeln.
Aktiv für den Generationswechsel
Der geschäftsführende Ausschuss hat die
Finanzierung und der Landesvorstand die
Einrichtung der begleitenden Kommission
bereits beschlossen. Auch der GEW-Haupt-
vorstand fördert das Projekt. In der ersten
Phase steht die quantitative Analyse der Ist-
situation im Fokus. Der qualitative Teil wird
Handlungsoptionen beinhalten und zusam-
men mit den Untergliederungen erarbeitet.
Dabei gilt es, „Handlungsansätze und
Maßnahmen festzuhalten, die erfolgver-
sprechend umgesetzt werden können, um
den Aktivitätsgrad der (jüngeren) Frauen im
Rahmen des Generationenwechsels zu ver-
bessern“. Dazu werden FunktionärInnen in
drei Modellregionen befragt sowie regionale
Workshops gehalten. Für die Ergebnisse der
quantitativen Analyse ist eine schriftliche
Präsentation vorgesehen. Mit den Ergebnis-
sen der qualitativen Analyse wird ein Hand-
lungsleitfaden erarbeitet.
Seid dabei!
Habt ihr schon gute Erfahrungen mit der
Aktivierung junger Frauen gemacht? Oder
seht ihr darin eine Chance, den Generatio-
nenwechsel vor Ort zu gestalten? Für den
Genderbericht suchen wir drei Untergliede-
rungen, die als Modellregion teilnehmen
– eine Mischung aus größeren Stadtverbän-
den und eher ländlich geprägten Regionen
(gerne auch einen Kreisverband).
Meldet euch bis 31. März 2014 bei
Maike Finnern: maike.finnern@gew-
nrw.de oder 0201-29403 27.
12 bildung