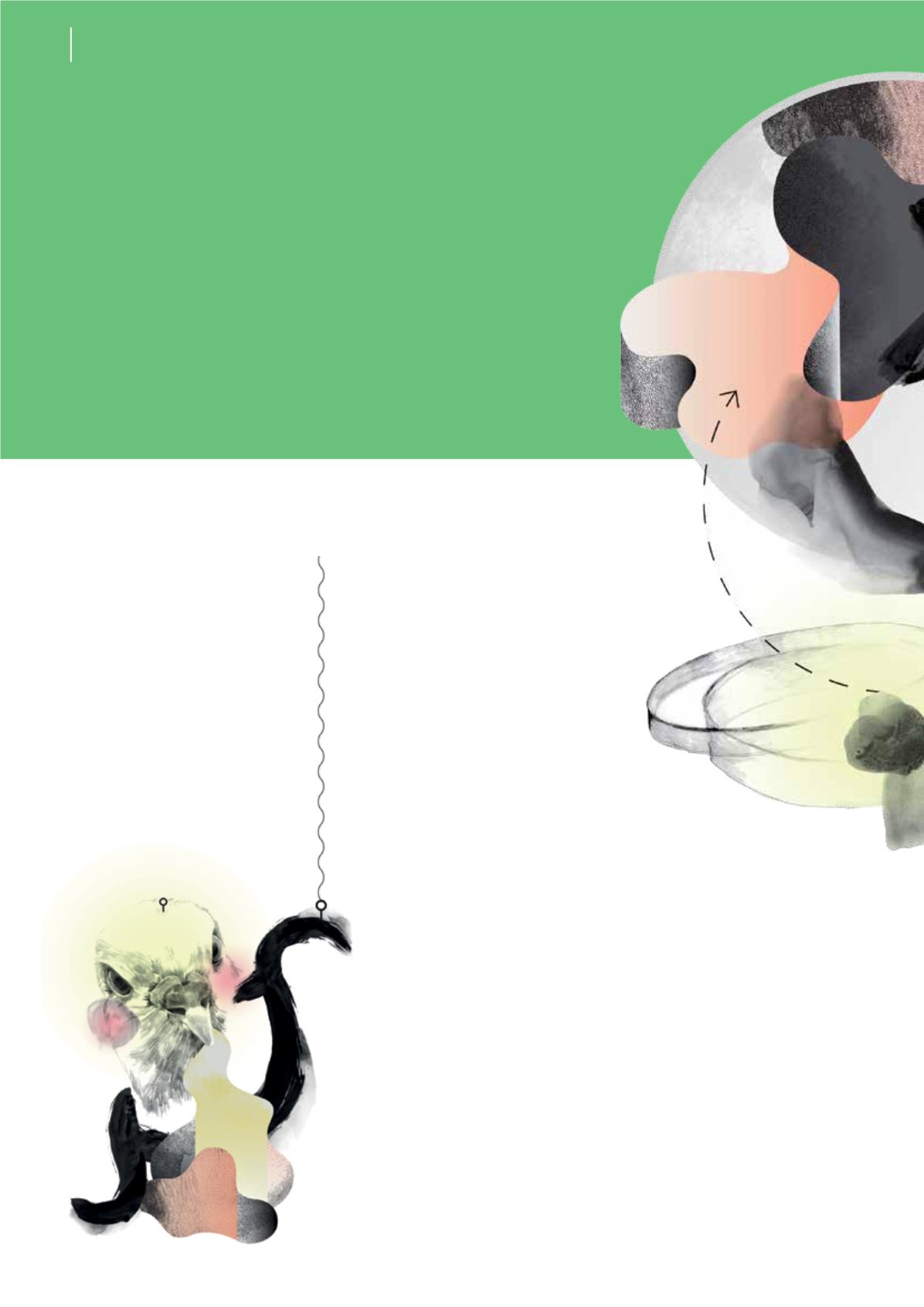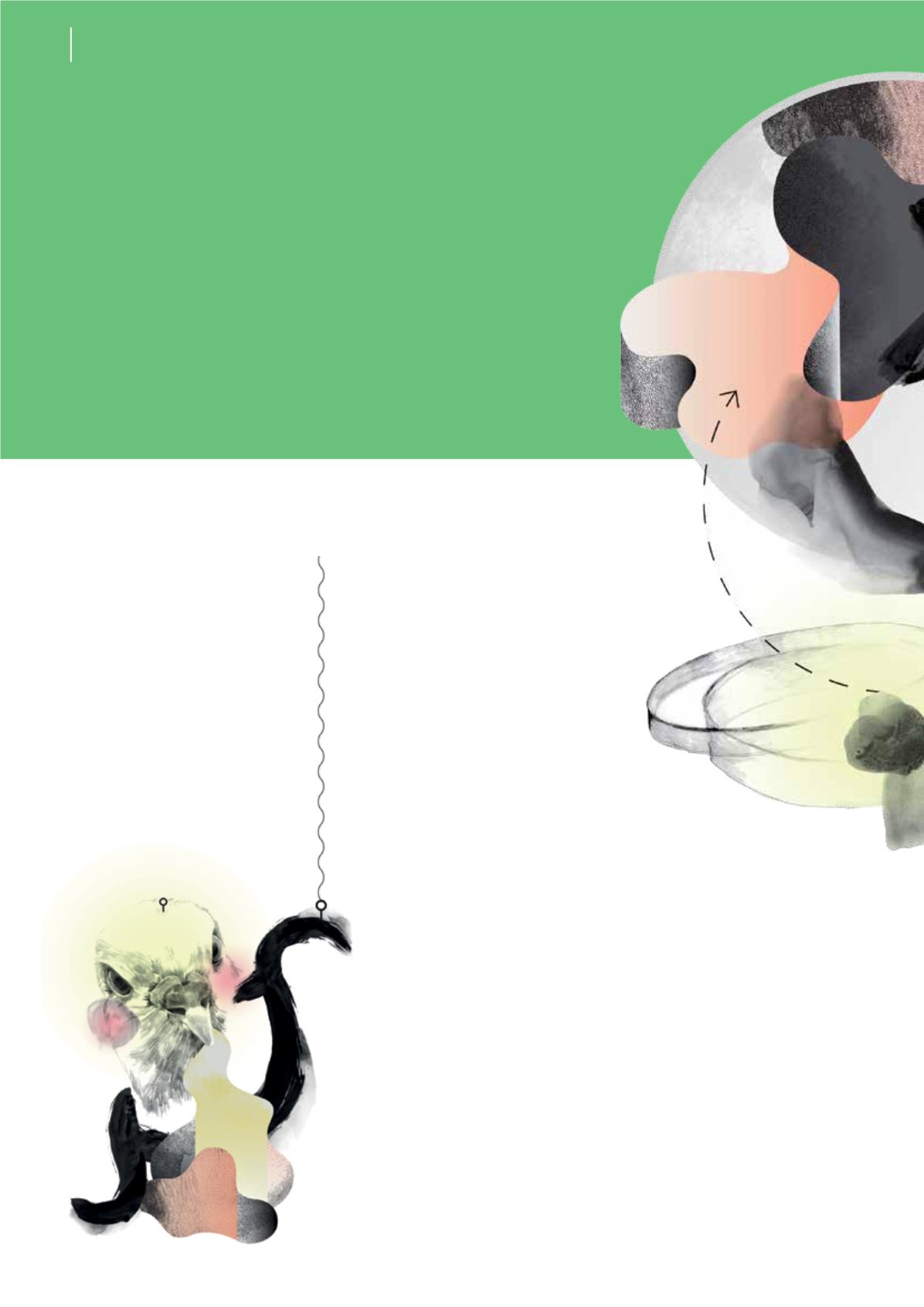
8
bildung
nds-Reihe: Bildung und Demokratie
Obacht, wer von Freiheit spricht
Bei der Kritik am Gesetzentwurf werden
recht große Worte verloren: „Freiheit, Auto-
nomie und Selbstverantwortung der Hoch-
schulen“ seien in Gefahr, heißt es in einem
offenen Brief des Deutschen Hochschulver-
bandes, der Standesorganisation der Univer-
sitätsprofessorInnen. Einen „Frontalangriff
auf die Wissenschaftsfreiheit“ abwehren zu
müssen, meint Prof. Axel Freimuth, Rektor
der Universität zu Köln. Es geht also um al-
les: Freiheit gegen Knechtschaft. Die großen
Worte sind kommunikationsstrategisch be-
wusst gewählt, da Begriffe wie „Freiheit der
Wissenschaft“ oder „Autonomie der Hoch-
schulen“ öffentlich uneingeschränkt positiv
besetzt sind und sich scheinbar von selbst zu
interpretieren scheinen.
In einer bundesweit koordinierten Kampagne haben sich RektorInnen, Präsiden-
tInnen, HochschulrätInnen und WirtschaftsvertreterInnen – kurz: die ganze
gute Gesellschaft – vereint im Kampf gegen den Entwurf für ein Hochschulzu-
kunftsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Strategisch klug gewählte Worte
tragen zur Debatte bei. Freiheit ist eines davon. Ein gewichtiges und eine Frage
der Definition.
Wissenschaftsfreiheit ist Grundrecht
Das hat immerhin den Vorteil, dass die
eigentlichen politischen Konfliktlinien dieser
Auseinandersetzung vernebelt werden. Dabei
wusste schon der Philosoph Georg Wilhelm
Friedrich Hegel um 1830 seinen HörerInnen
in seinen Vorlesungen zur Philosophie der
Geschichte mitzuteilen: „Man muß, wenn von
Freiheit gesprochen wird, immer wohl achtge-
ben, ob es nicht eigentlich Privatinteressen
sind, von denen gesprochen wird.“
Zunächst gilt zweifelsfrei: Wissenschafts-
freiheit ist ein Grundrecht (Grundgesetz Art.
5 Abs. 3) und ein historisch überliefertes
Rechtsgut. Sie gehört zum Ensemble der
klassischen bürgerlichen Grundrechte in ihrer
Funktion als Abwehrrechte gegen Fremdbe-
stimmung – und damit als Voraussetzung für
Selbstbestimmung und Selbstgesetzgebung.
Historisch haben sich die damit verbun-
denen Vorstellungen schrittweise durch-
gesetzt im Zuge der Emanzipation der
Wissenschaft von Religion und feudal-
absolutistischer Bevormundung.
Regeln der institutionellen
Wissenschaftsfreiheit
Ein vorläufiger Höhepunkt in diesem Pro-
zess ist die Gründung der Berliner Universi-
tät im Jahr 1810 auf Initiative Wilhelm von
Humboldts. Auf diese Weise entstand über-
haupt erst in ihren Anfängen eine geschütz-
te autonome institutionelle Sphäre wissen-
schaftlicher Vernunft, die den Anspruch hatte,
ausschließlich ihren eigenen Regeln – und
keinerlei gesellschaftlichen Partikularinter-
essen – zu folgen.
Als Schutz- beziehungs-
weise Abwehrrecht ist Freiheit rein formal und
ausschließlich negativ bestimmt: Freiheit von
etwas. In jedem Fall wurzelt die Vorstellung,
dass Hochschulen autonom sein müssen, in
dieser Tradition einer autonomen Wissen-
schaft.
Damit ist die Diskussion keineswegs ab-
geschlossen, sondern steht erst am Anfang.
Schließlich ist die Frage aufgeworfen, wie die-
se Wissenschaft sich selbst regelt. Diese Frage
konnte historisch nie eindeutig beantwortet
werden, sondern benennt eher einen politi-
schen Dauerkonflikt. Der größte gemeinsame
Nenner dabei ist der Gedanke einer Selbstver-
waltung der Wissenschaft. Sie ist in Deutsch-
land verfassungsrechtlich vorgeschrieben, da
dies laut Bundesverfassungsgericht (BVG)
der Autonomie der Wissenschaft und deren
Schutz entspricht. Das BVG verwendet daher
Illustrationen: I. Wilde