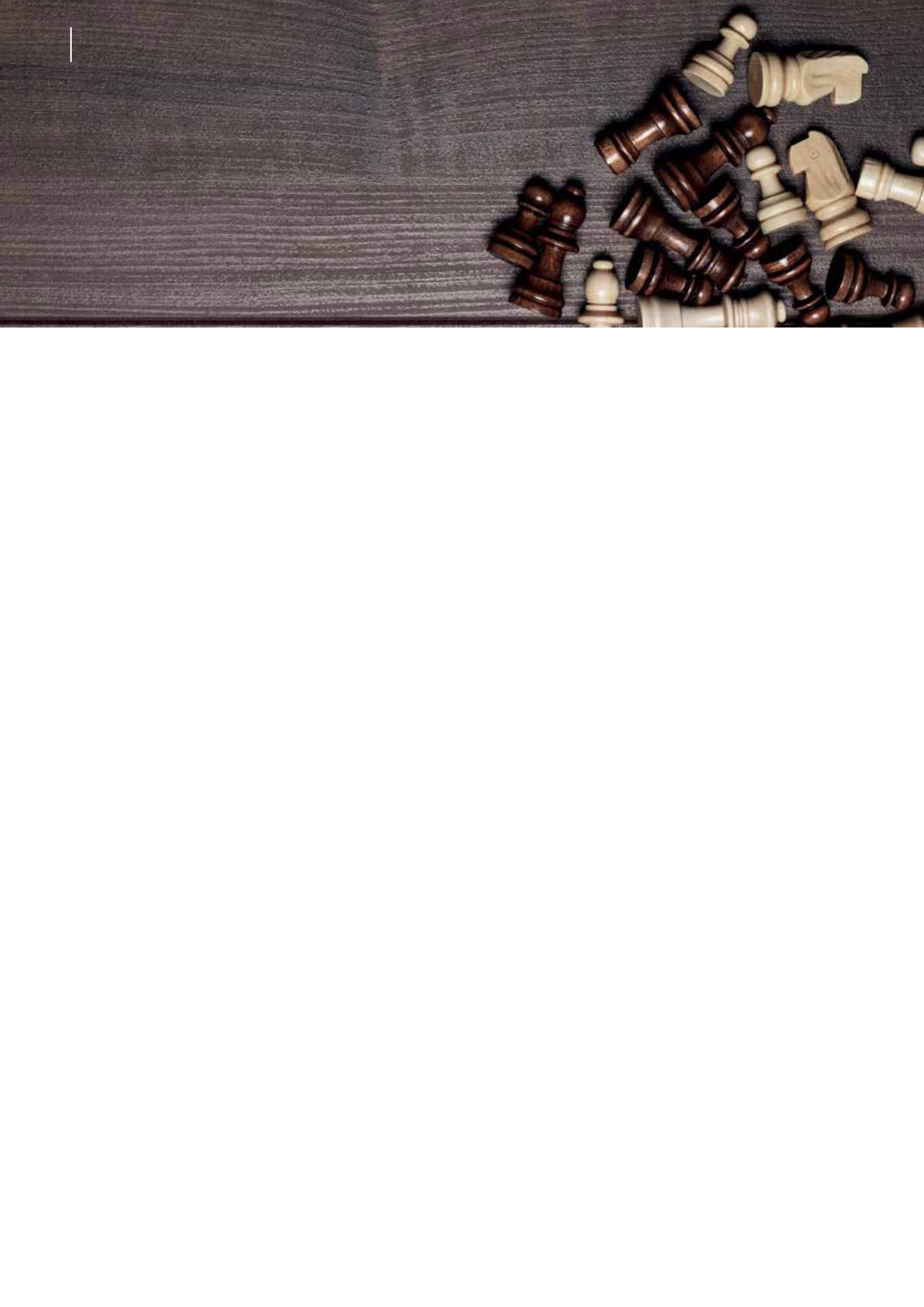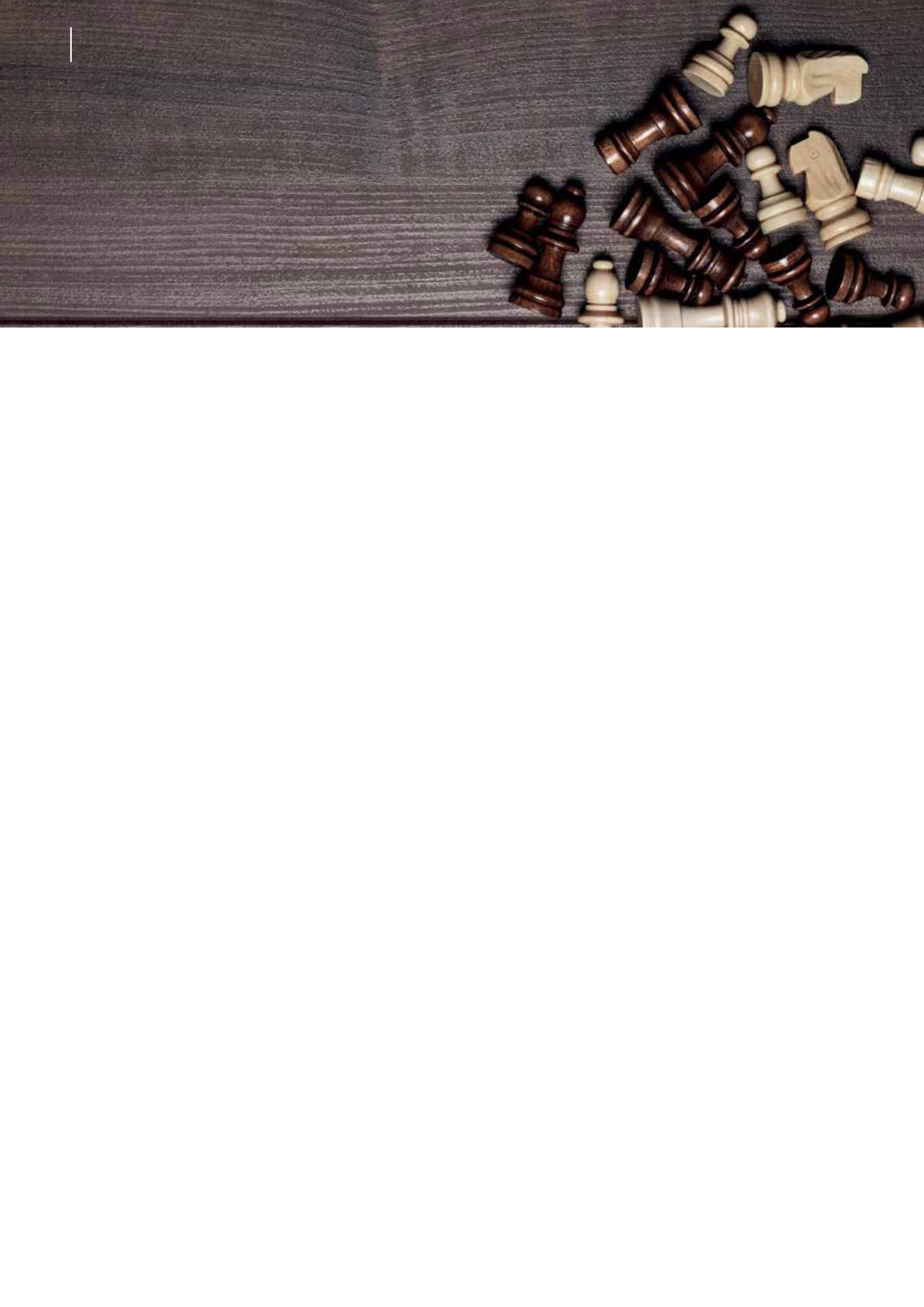
10
bildung
Hochschulzukunftsgesetz
Wissen(schaft) ist Macht
Es geht um die Vermachtung der veröffent-
lichten Meinung im Sinne der konservativen
Wortführer. Es geht um die Entmachtung der
Kritiker der „unternehmerischen“ Hochschule,
die kaum noch zu Wort kommen. Und es geht
um eine neue Machtverteilung in den Hoch-
schulen. Was soll genau sich verändern? Das
überraschende Ergebnis: nicht viel.
Autokratisches Management gestärkt
Das Präsidium hat nach wie vor eine starke
Machtstellung und wie bisher kann die Grund-
ordnung regeln, dass keine Beschlüsse gegen
die Stimme der Präsidentin oder des Präsi-
denten gefasst werden. Im Gegensatz zu heu-
te schlägt die Präsidentin oder der Präsident
künftig sogar noch die VizepräsidentInnen für
Wirtschaft und Personal vor. Die autokratische
Struktur wird also eher noch gestärkt.
Vielleicht stört ja die RektorInnen, dass
künftig (§ 33 RefEntw) das Ministerium wie-
der ihr Dienstvorgesetzter sein „kann“, sofern
die Ministerin nicht ihre Befugnisse auf die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Hoch-
schulrats überträgt. Vielleicht ist es den Präsi-
dentInnen ja nicht so Recht, dass künftig (§
20 Abs. 5 RefEnt) die anonymisierte Gesamt-
summe und der anonymisierte Durchschnitt
der Bezüge der Präsidiumsmitglieder an geeig-
neter Stelle veröffentlicht werden soll. Anson-
sten ist den Top-down-Entscheidungsbefugnis-
sen des Hochschulmanagements gegenüber
der derzeitigen Rechtslage kein bisschen Mehr
an demokratischen Kontrollmöglichkeiten ent-
gegengestellt worden.
Macht der Aufsichtsräte ausgeweitet
Auch die einer Aktiengesellschaft nachge-
bildete Aufsichtsratsstruktur der Hochschul-
räte bleibt erhalten. Die Zuständigkeiten
und Kompetenzen des Hochschulrats werden
nicht etwa auf eine Beratungsfunktion einge-
schränkt, sondern dessen Entscheidungs- und
Kontrollbefugnisse werden sogar noch aus-
geweitet. So soll der Hochschulrat künftig in
finanziellen Belangen noch stärkeren Einfluss
bekommen und die Aufsicht über die Wirt-
schaftsführung des Präsidiums wahrnehmen,
ja (§ 16 Abs. 4 RefEntw) sogar bei Streitig-
keiten über rechtliche und Fragen der Wirt-
schaftlichkeit den Letztentscheid haben.
Wegen einer angeblichen Stärkung des
Senats wird der Einfluss von Hochschulver-
treterInnen im Hochschulrat sogar noch ge-
schwächt, weil er nur noch durch Externe be-
setzt werden soll (§ 21 Abs. 3 RefEntw). Es ist
zwar richtig, dass die bisherigen internen Mit-
glieder des Hochschulrats nicht das gesamte
Spektrum der Hochschulen repräsentierten,
aber bei nur externer Besetzung geht dem
Hochschulrat jeglicher, nicht durch das Präsi-
dium gefilterte Kontakt zu den Problemen der
Hochschule vor Ort vollends verloren.
Ohnmacht des Senats
Von einer in der Begründung zum Refernte-
nentwurf erwähnten Stärkung des Senats ist
in § 22 RefEntw nicht viel zu erkennen. Bis
auf die Mitwirkung in der Hochschulwahlver-
sammlung und dem Recht zur Stellungnahme
in Angelegenheit der Forschung, Kunst, Lehre
und des Studiums, die die gesamte Hochschu-
le betreffen, bleibt die Ohnmacht gegenüber
der Hochschulleitung und vor allem dem
Hochschulrat beim Alten.
Placebo Mitgliederinitiative
Nicht mehr als ein Placebo für die Stärkung
demokratischer Strukturen ist auch die Kann-
bestimmung, dass die Grundordnung einer
Hochschule eine „Mitgliederinitiative“, also so
etwas wie ein Hochschulreferendum vorsehen
kann. Wenn schon Plebiszite, dann aber bitte
schon durch das Gesetz und nicht im Belieben
der Hochschule. Durch eine solche plebiszitäre
Initiative kann allerdings kein Beschluss eines
Gremiums korrigiert werden – insofern kaum
mehr Demokratie, dafür viel weiße Salbe.
Kraftprobe auf ganz anderem Feld
Die Organisationsstruktur und das Macht-
gefüge innerhalb der Hochschule werden
durch den Referentenentwurf nicht verändert,
geschweige denn demokratisiert. Dass künftig
Frauenquoten in Gremien oder dass die Ver-
tretung der Statusgruppen gesetzlich vorge-
schrieben werden soll, kann Ton und Form des
Widerstands gegen das Hochschulzukunftsge-
setz nicht erklären.
Es geht um einen Machtkampf, den die Re-
präsentanten und Verteidiger der funktionell
privatisierten „unternehmerischen“ Hochschu-
le mit der Politik, also mit der Regierung und
dem Gesetzgeber austragen. Es geht um ein
vom neoliberalen Zeitgeist geprägtes Leitbild,
in dem Wettbewerb als optimales Steuerungs-
instrument für das Unternehmen Hochschule
angesehen wird und in dem der Staat und die
Interessen der Allgemeinheit keine Rolle mehr
spielen dürfen und sollen.
Die Kritik geht an der Sache vorbei
Es ist schon eine denkwürdige Gefechtsla-
ge, in die sich diese Kritiker des Hochschul-
zukunftsgesetzes hineinbegeben: Da wird
auf der einen Seite in geradezu irrationaler
Weise hinter jeder neuen Regelung, selbst
wenn sie freiheitsverbürgender ist oder wenn
sie den Hochschulen weniger abverlangt als
das geltende Gesetz, ein „Misstrauensvotum“
gegenüber den Hochschulen gesehen und als
Eingriff in die Hochschulautonomie bekämpft,
während keinerlei Verlust an Freiheit der Wis-
senschaft und an Autonomie gesehen wird,
wenn Hochschulen ganz unmittelbar im Auf-
trag privater Geldgeber forschen. Merkt man
eigentlich gar nicht, dass dabei der Verdacht
aufkommen muss, dass die Abwehr von Staat
eigentlich nur den Zweck haben kann, die Ab-
hängigkeit von privaten Interessen zu erhöhen
und durch Geheimhaltung zu vertuschen?
Der Wesenskern für die Begründung der ver-
fassungsrechtlichen Garantie der Freiheit der
Die Kritik am Referentenentwurf eines Hochschulzukunfts-
gesetzes für NRW hat geradezu hysterische Züge angenom-
men. Im Kern geht es dabei vor allem um eines: Macht.
Foto: Ruslan Grumble - Fotolia.com